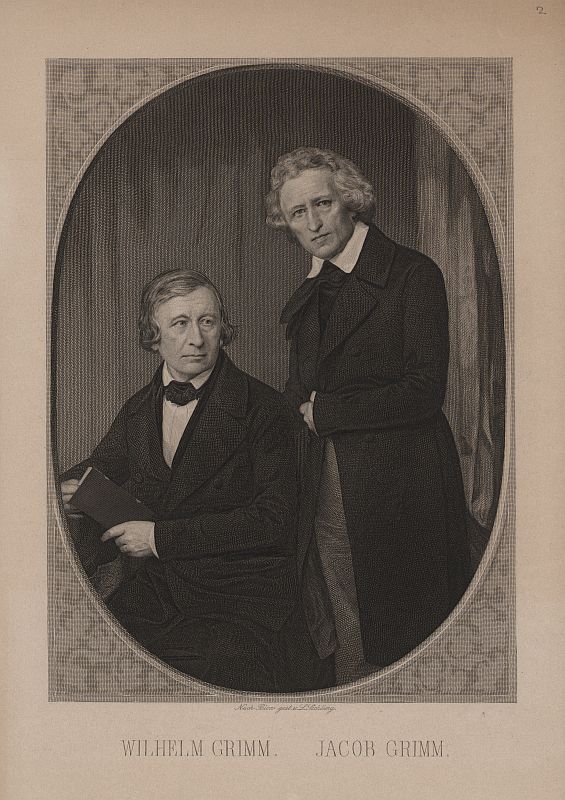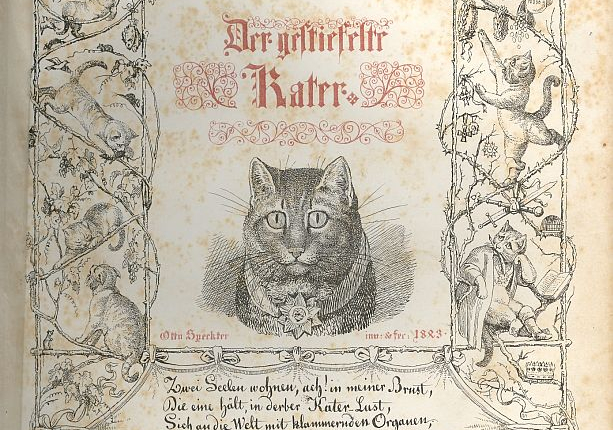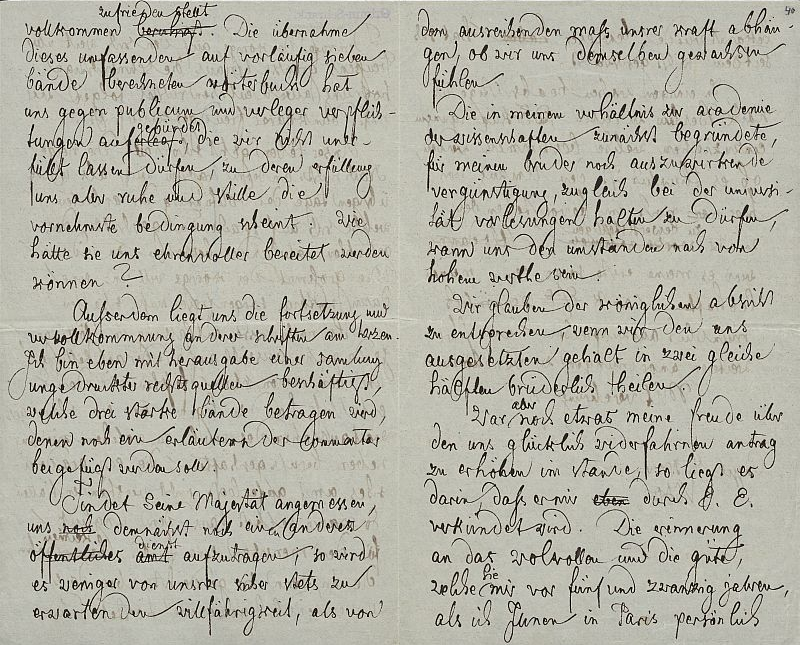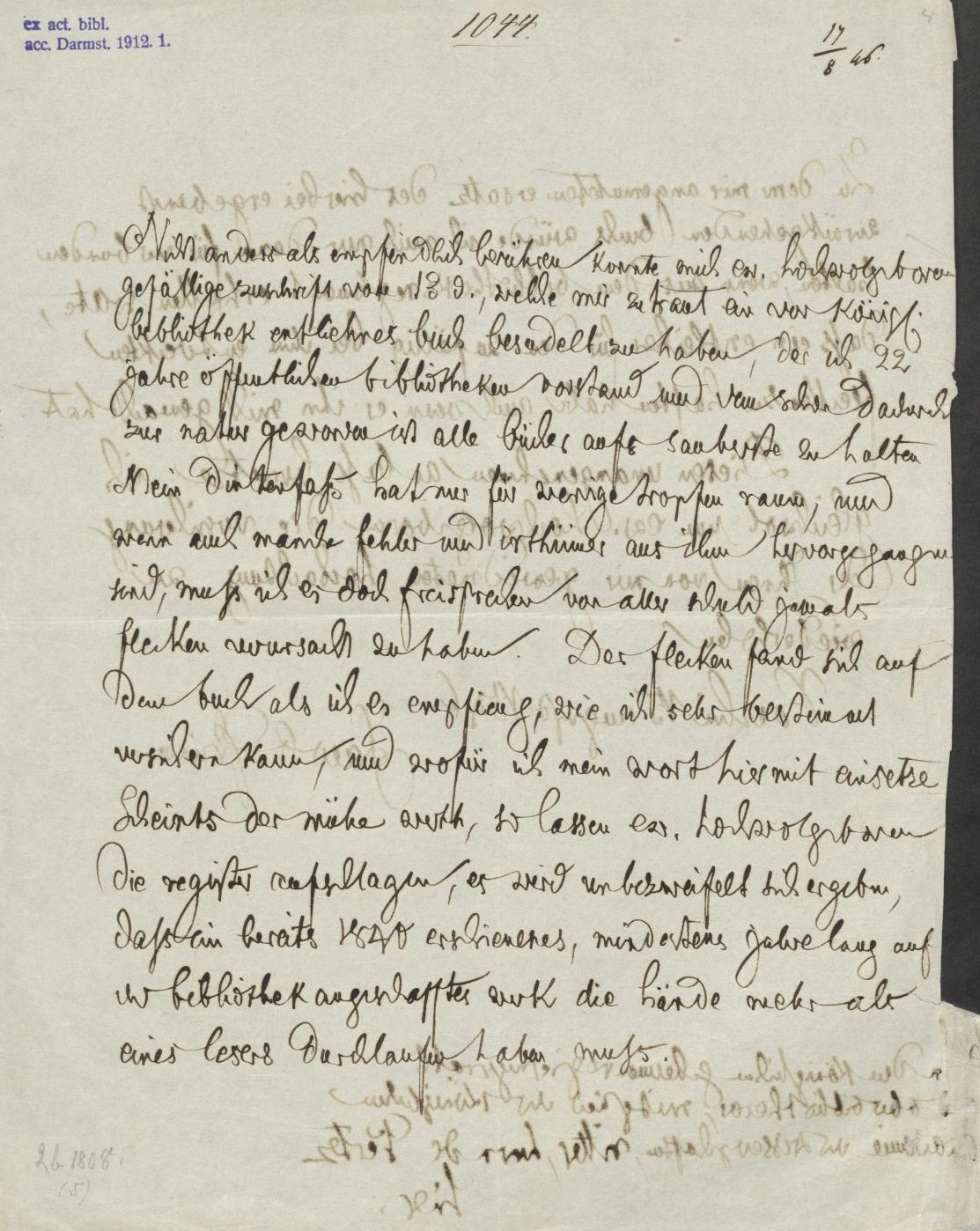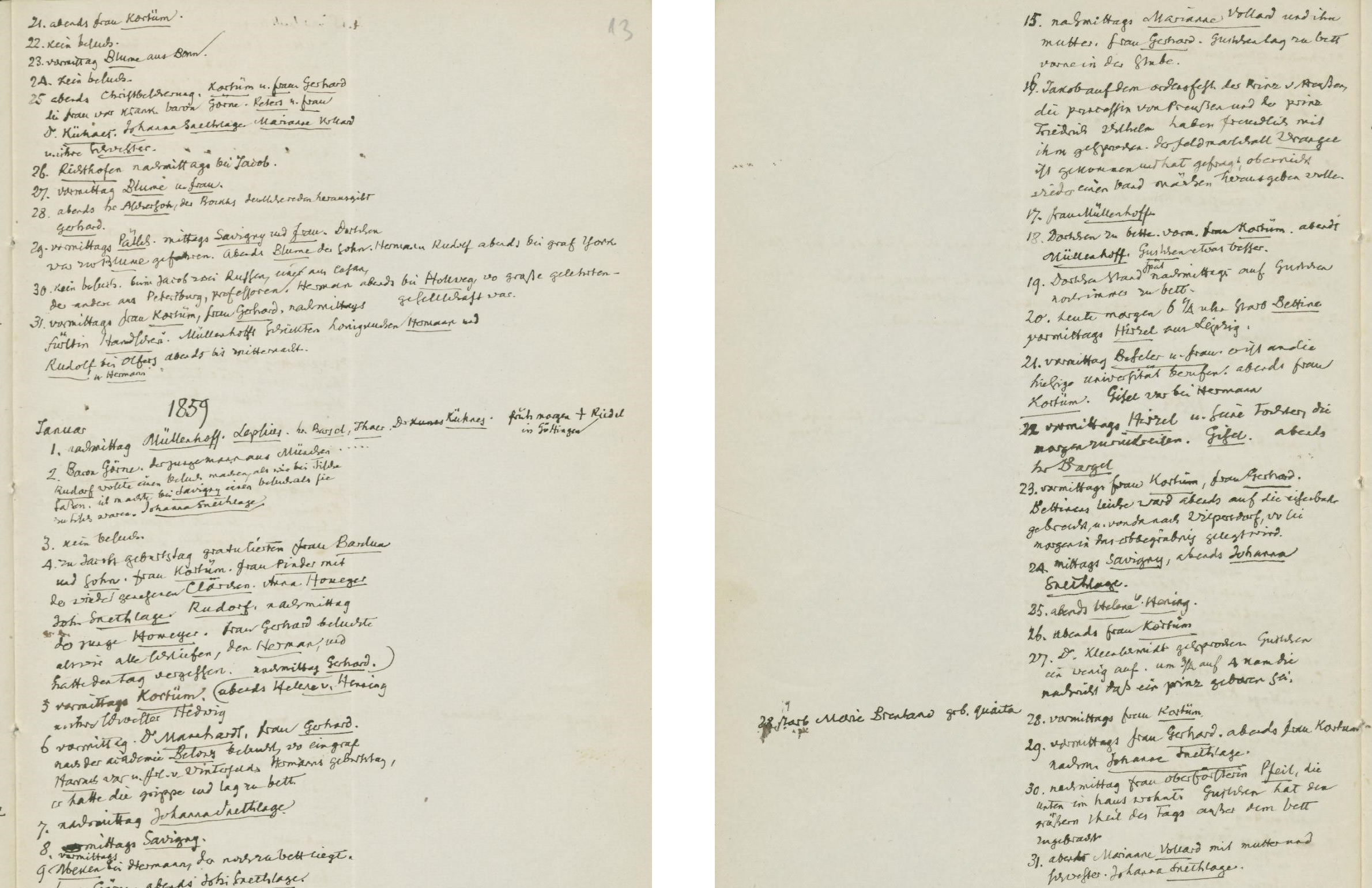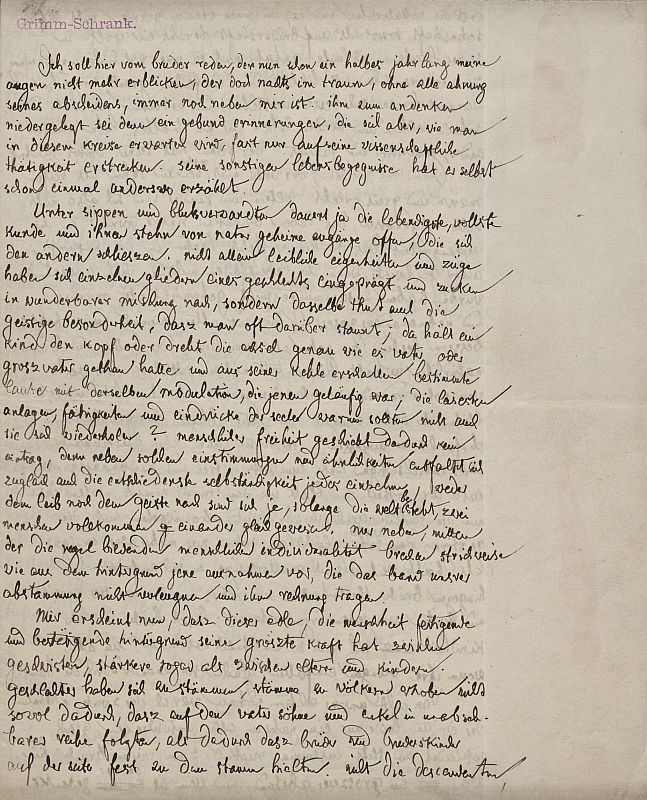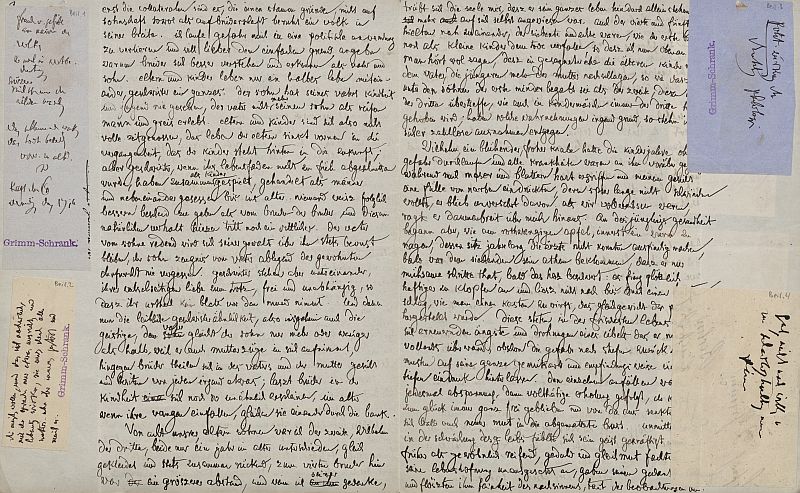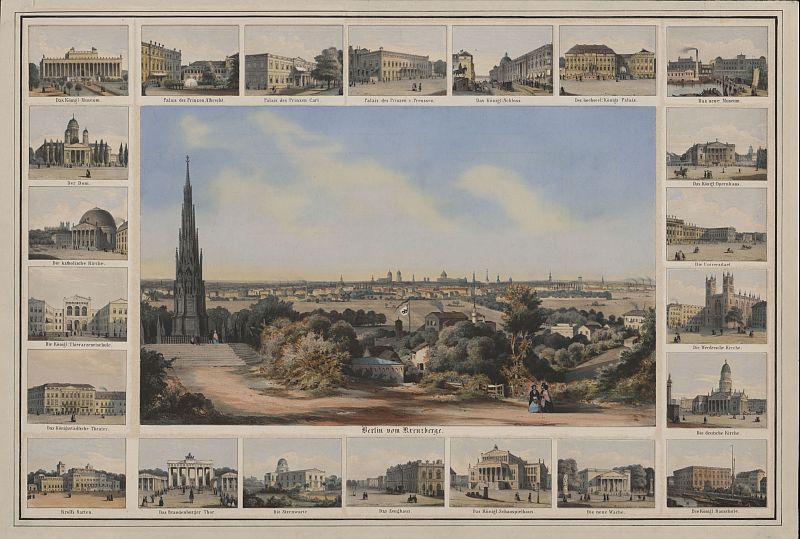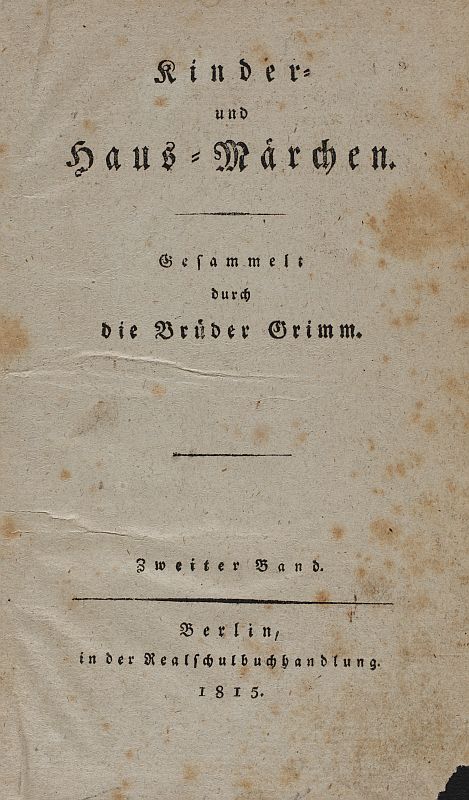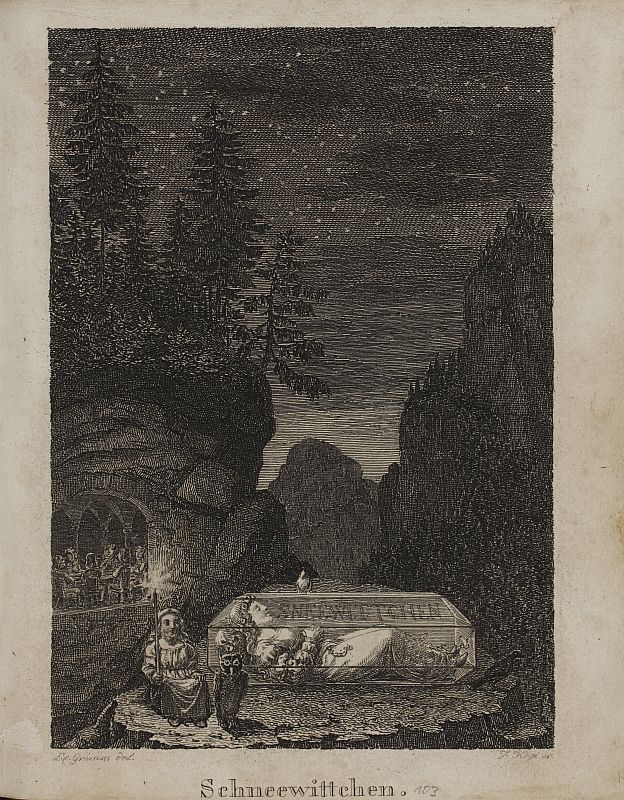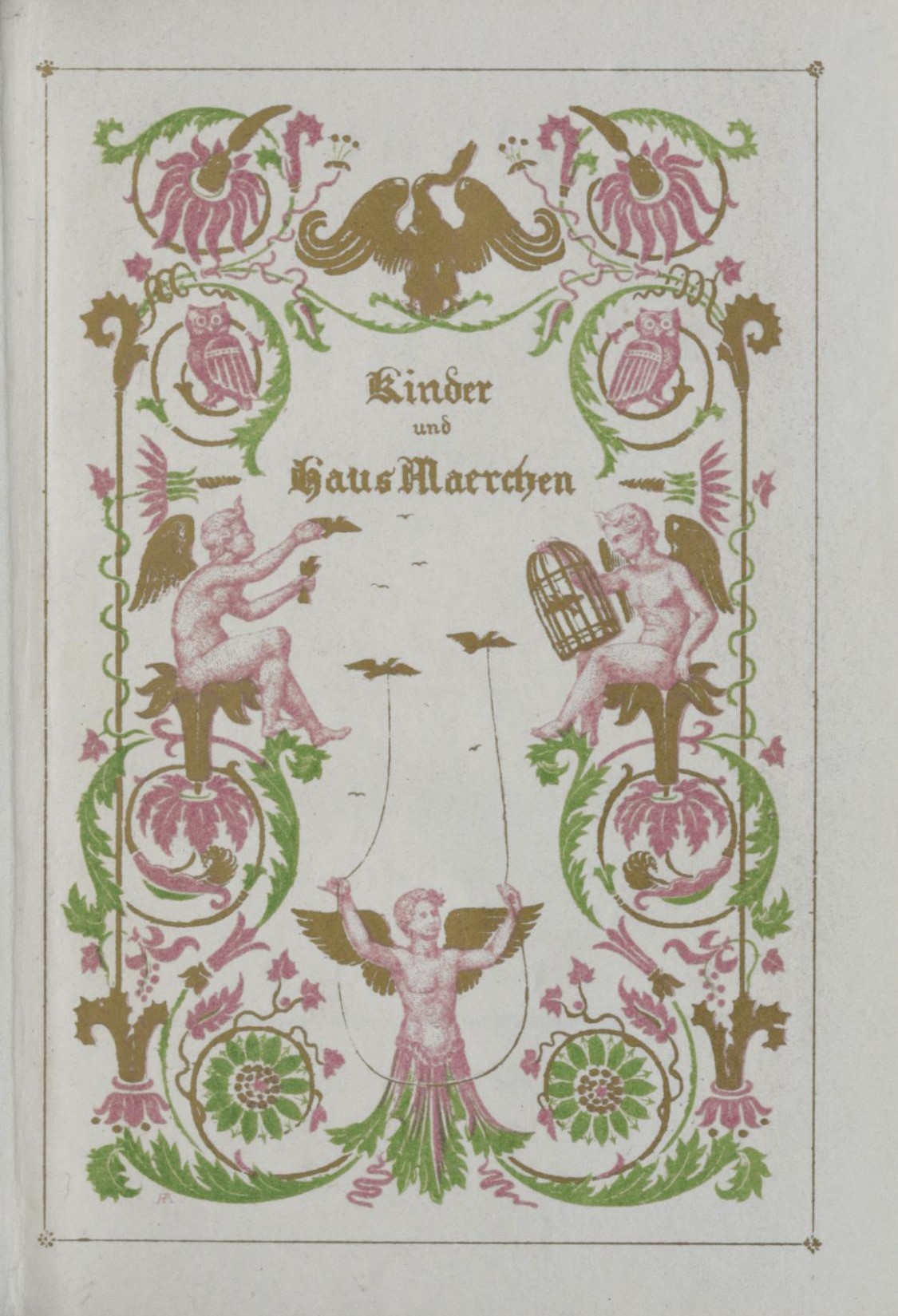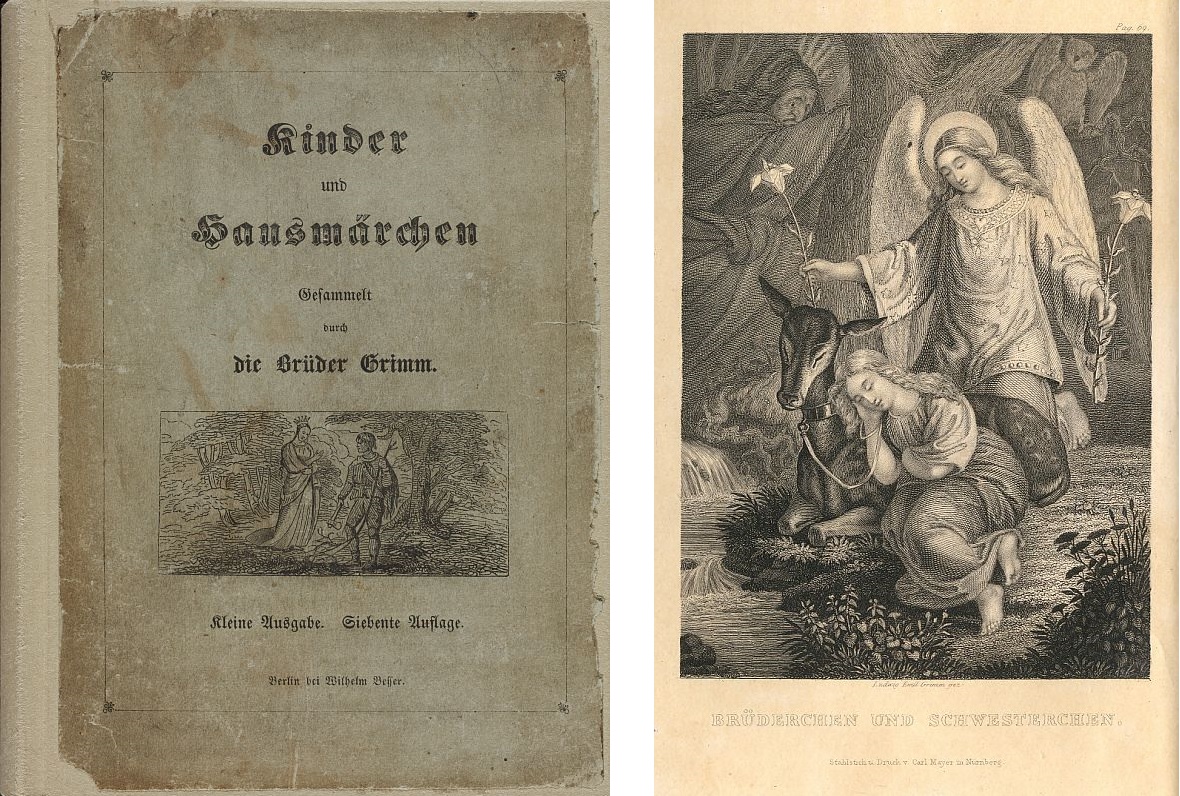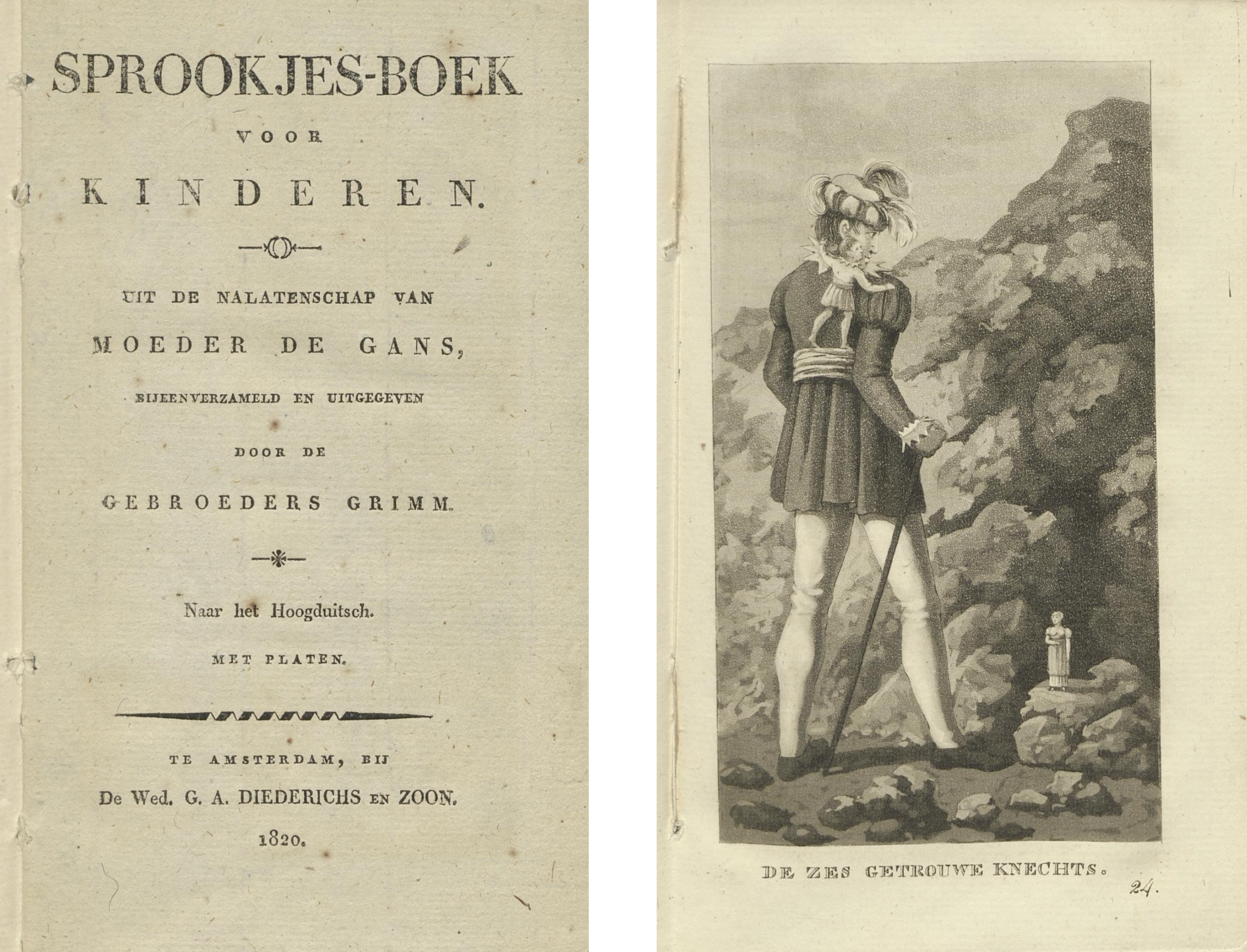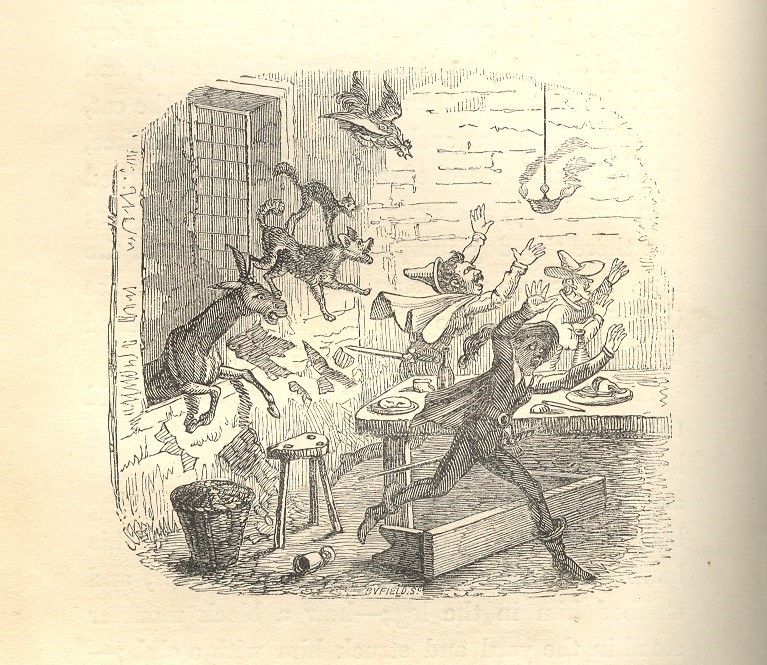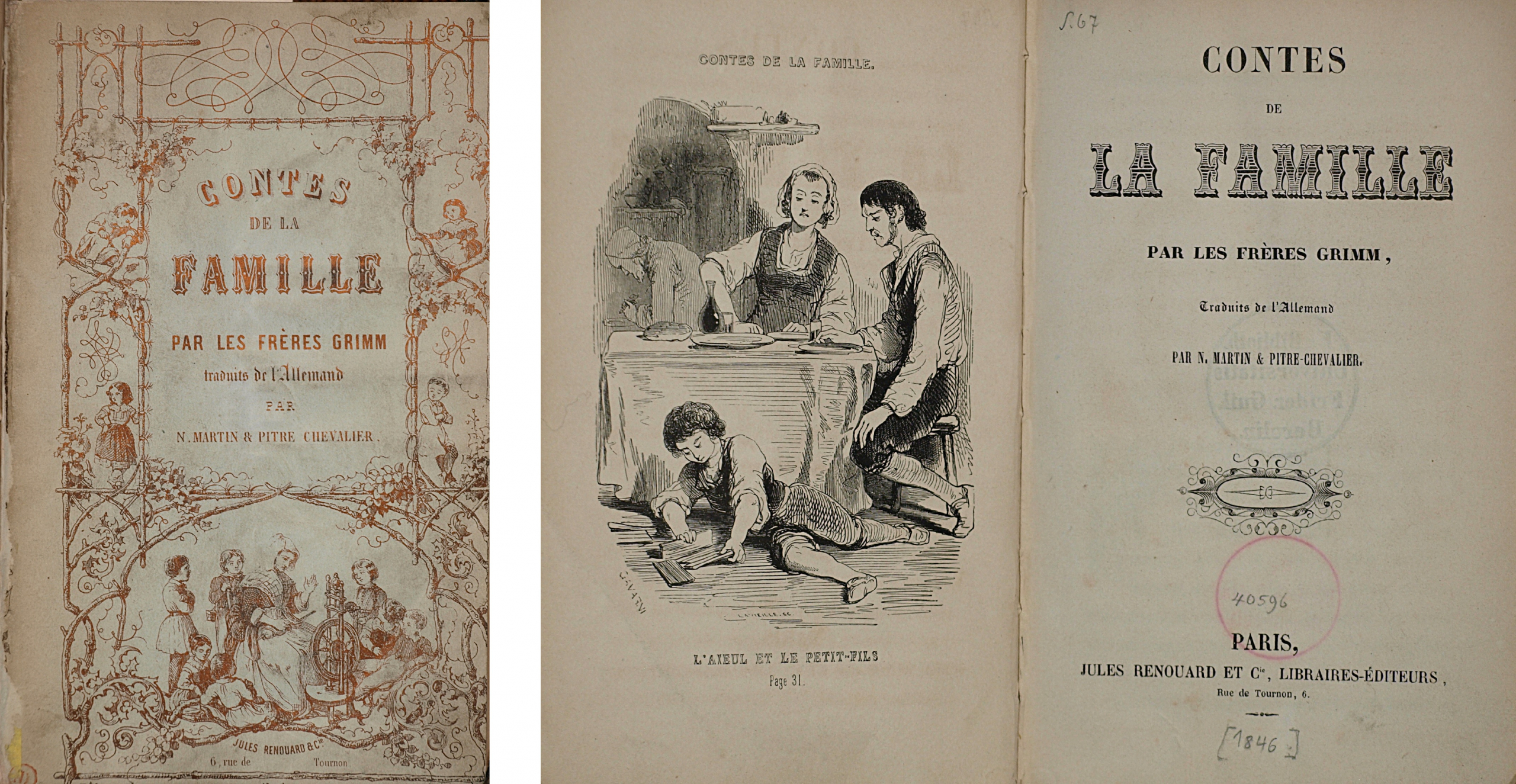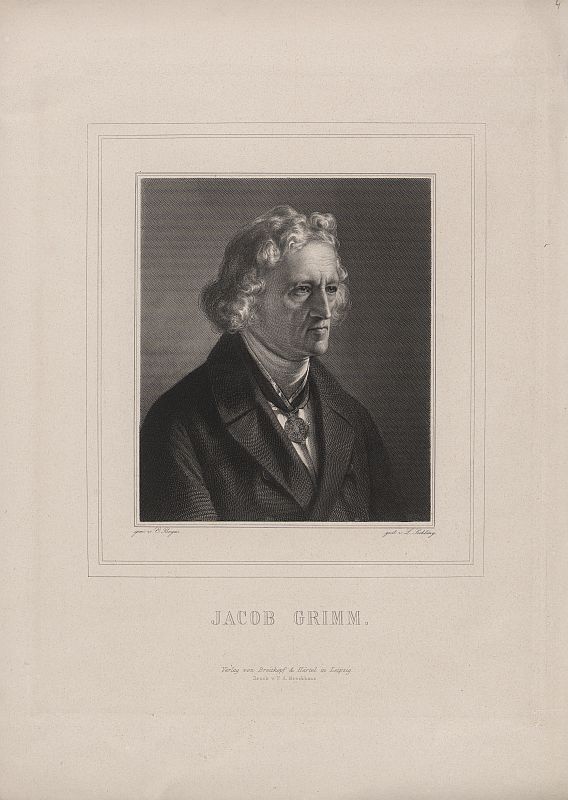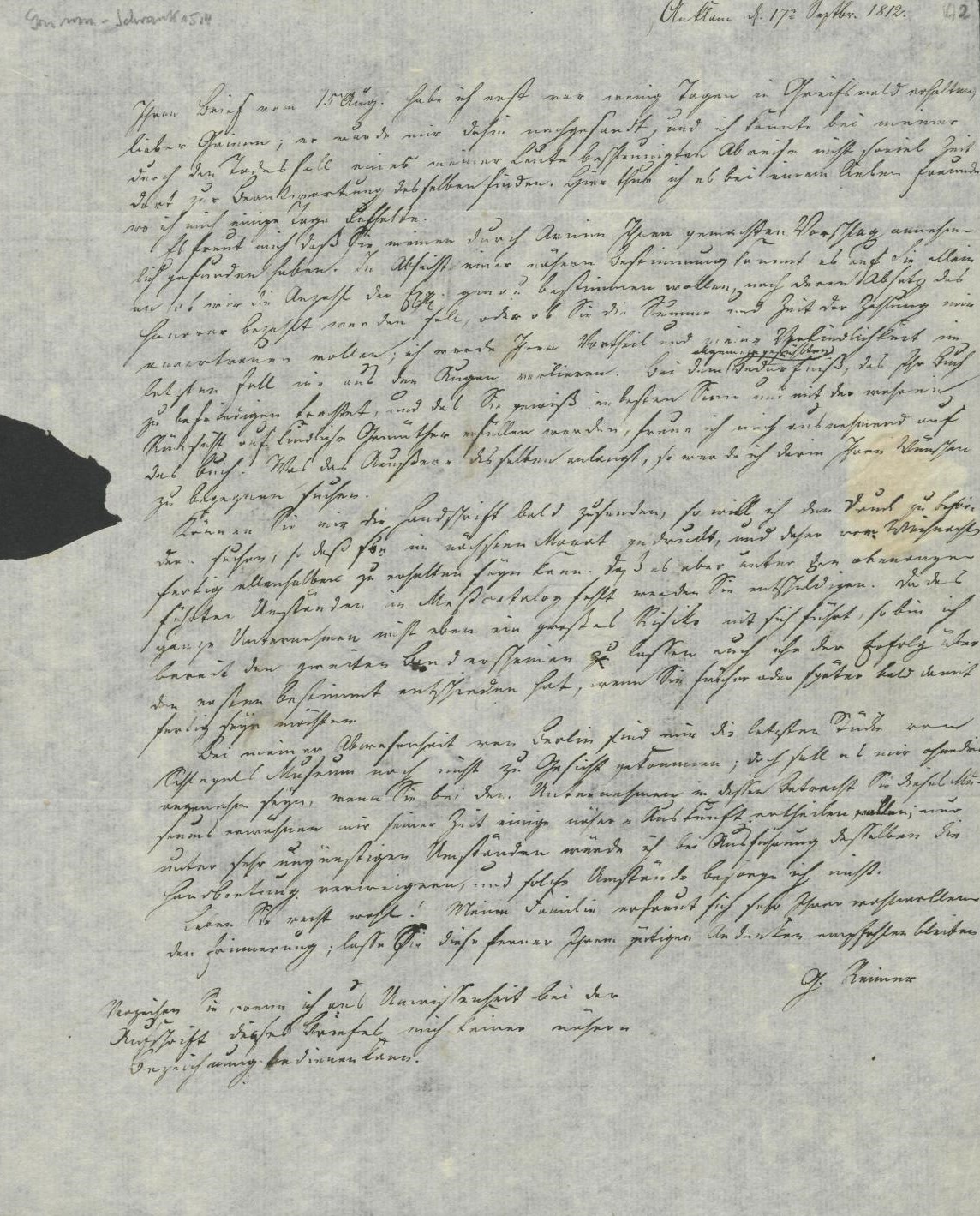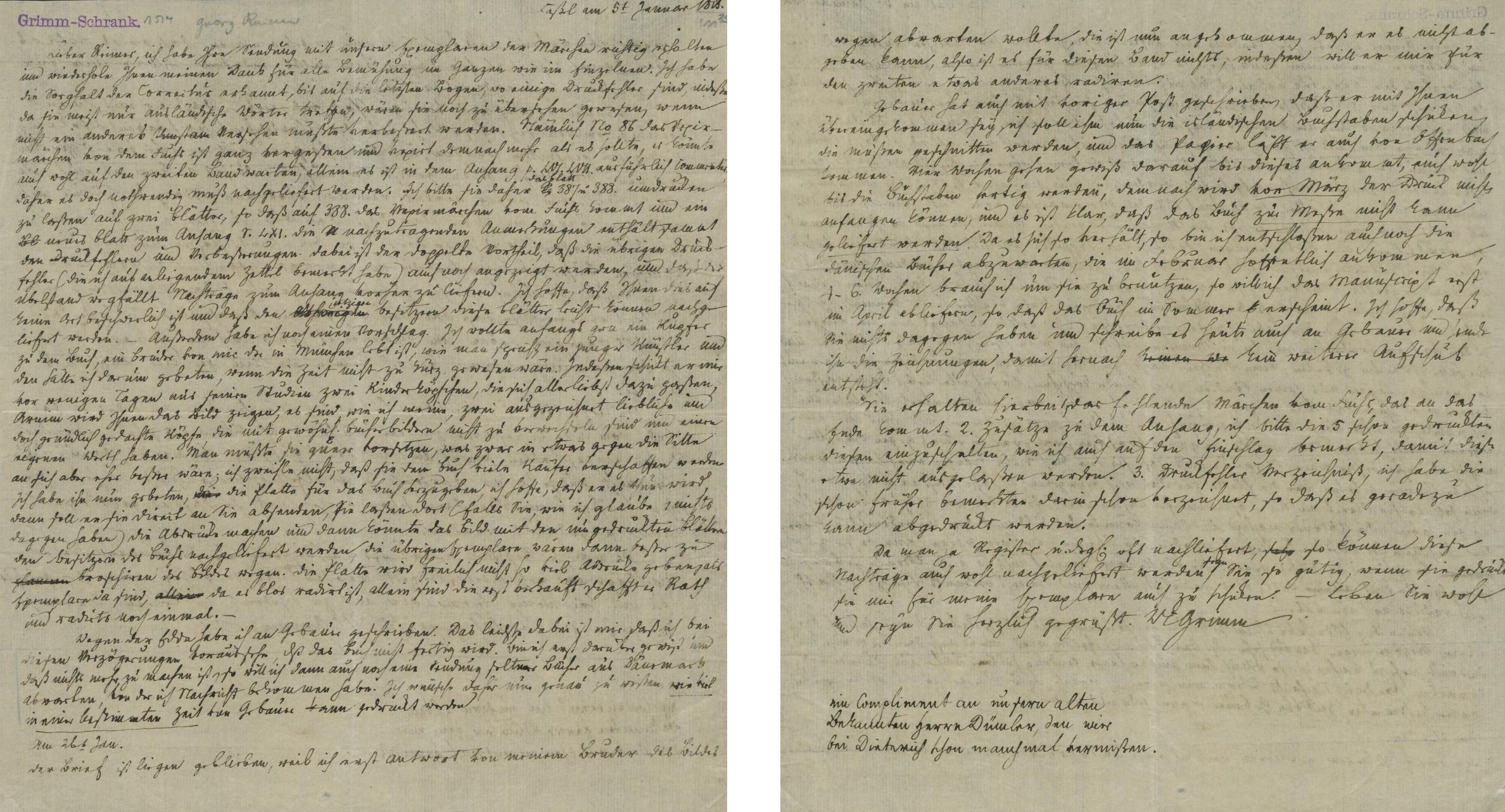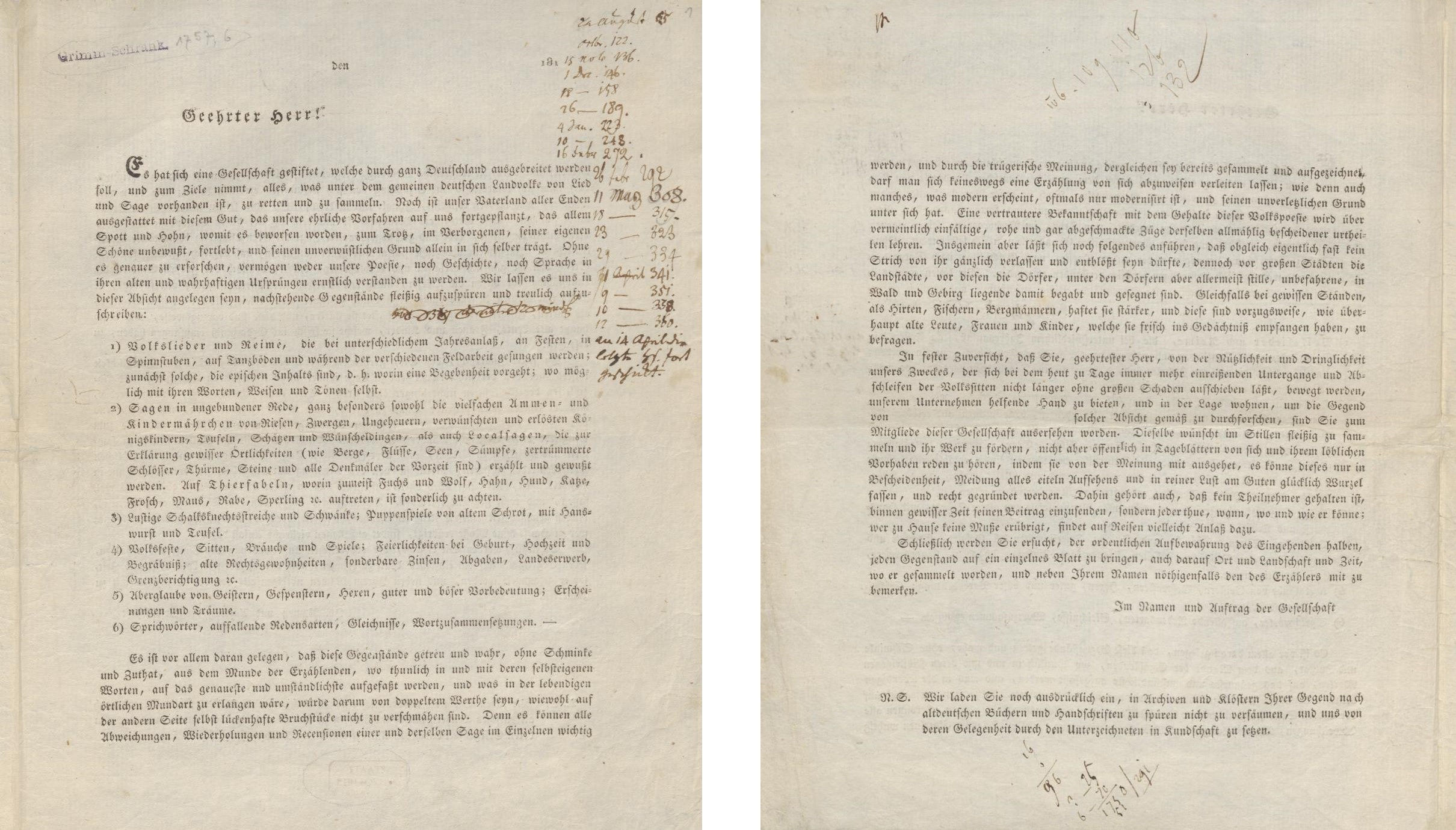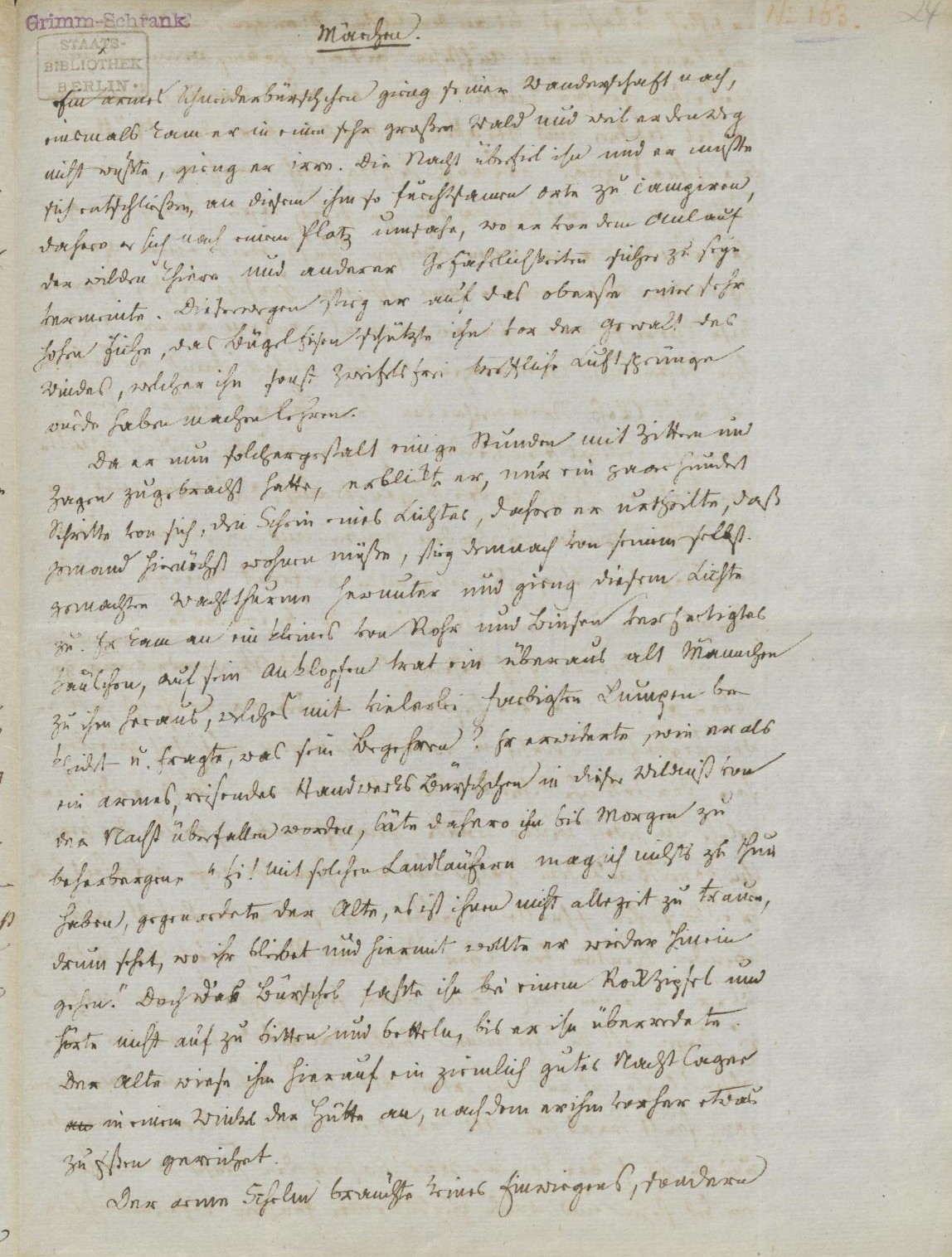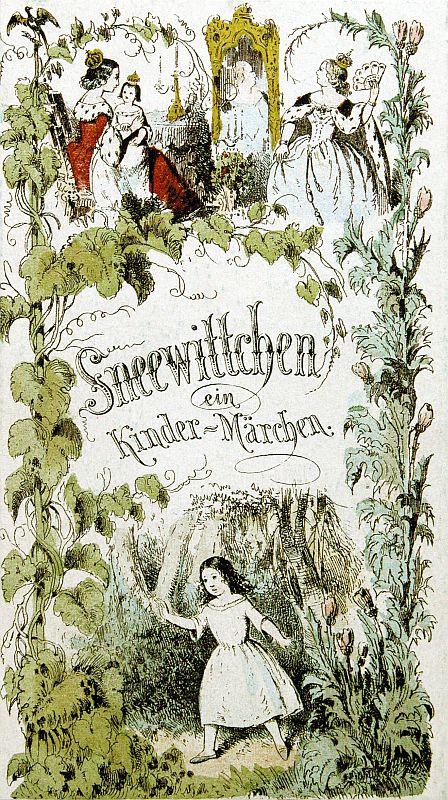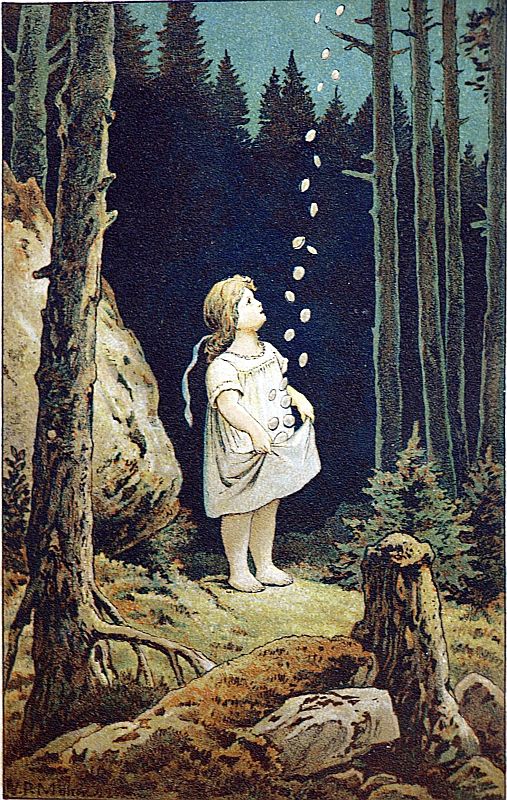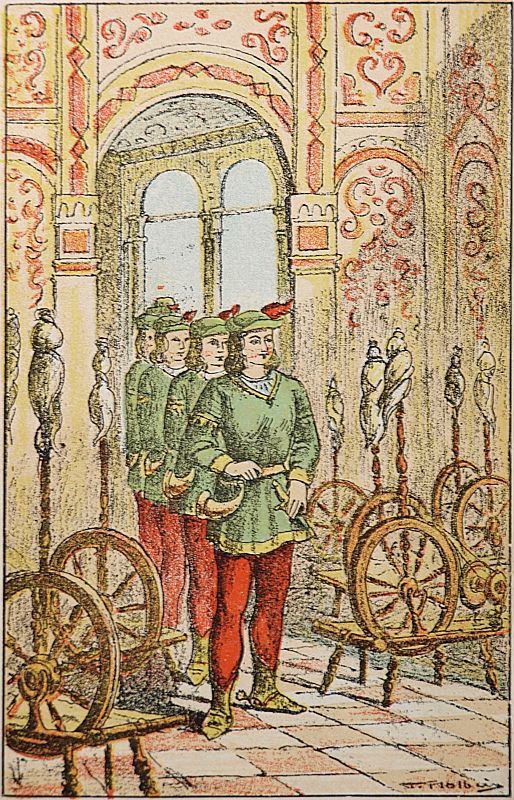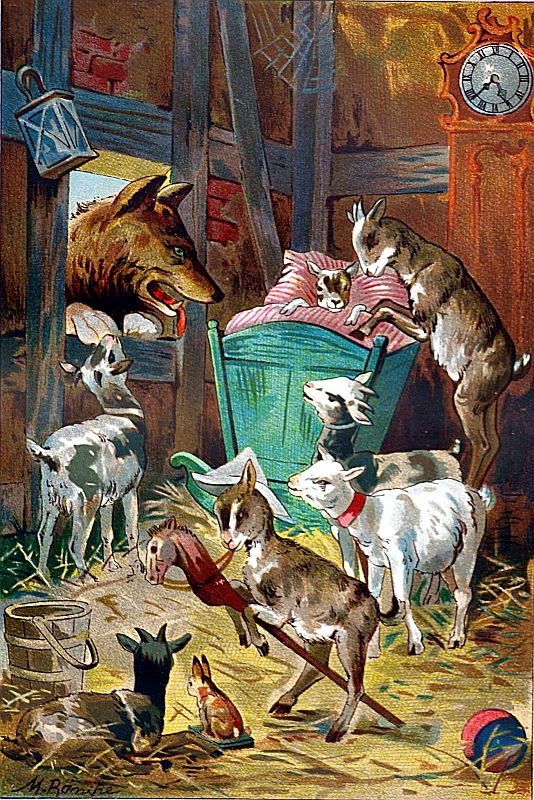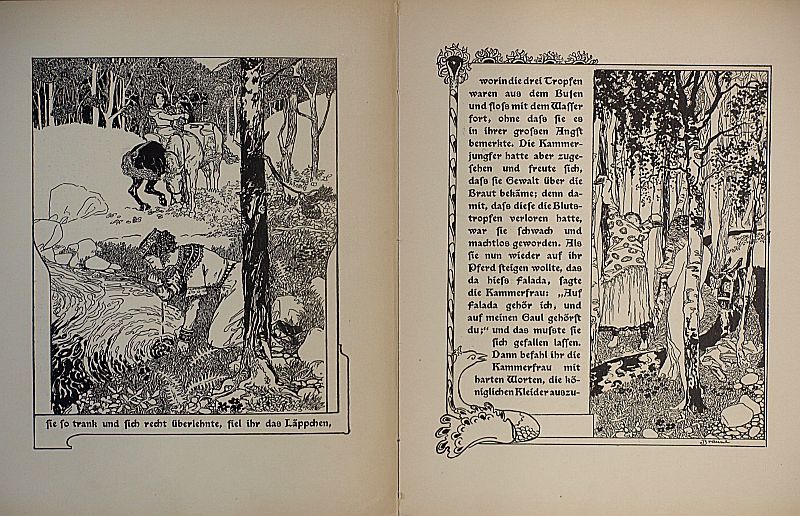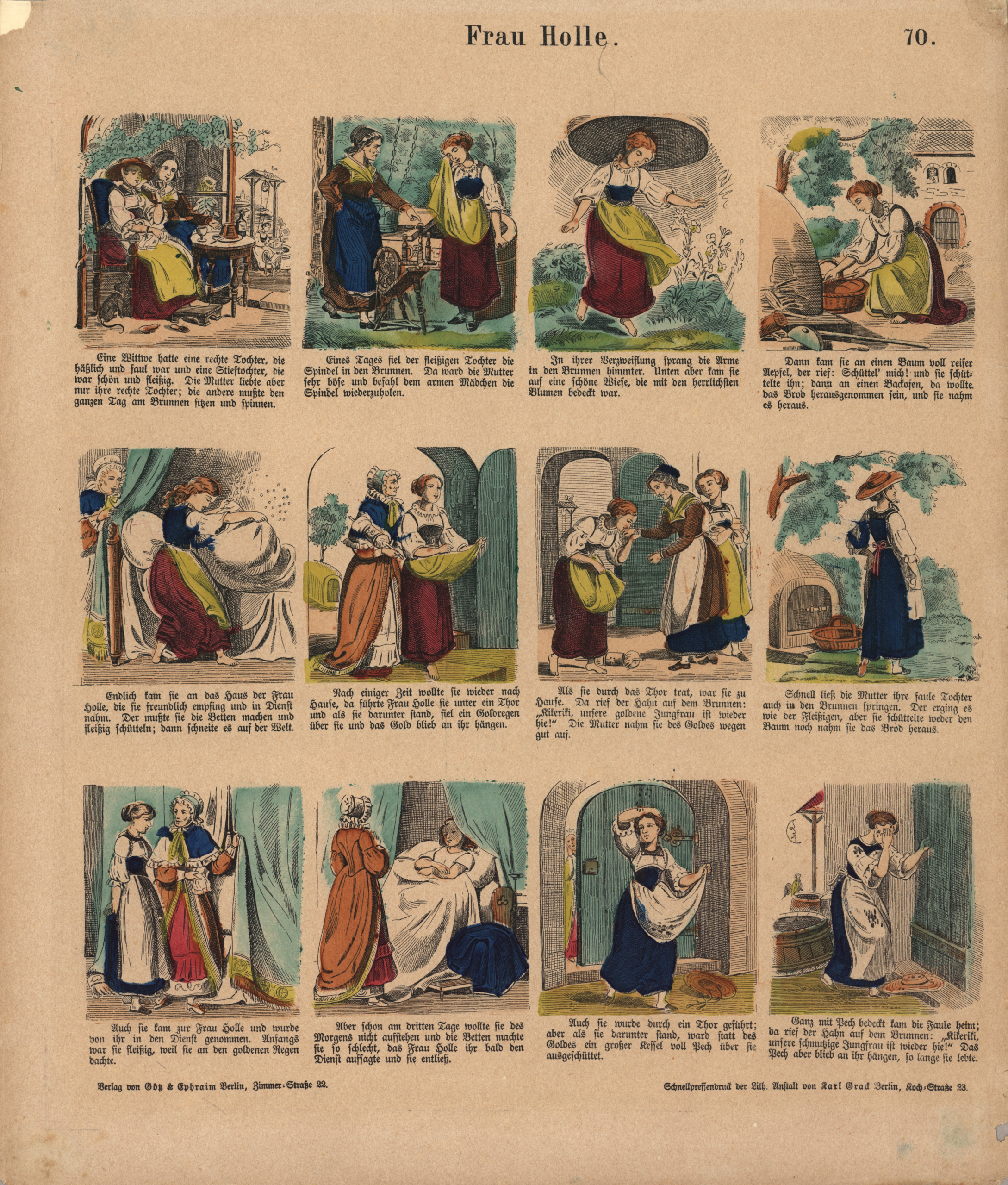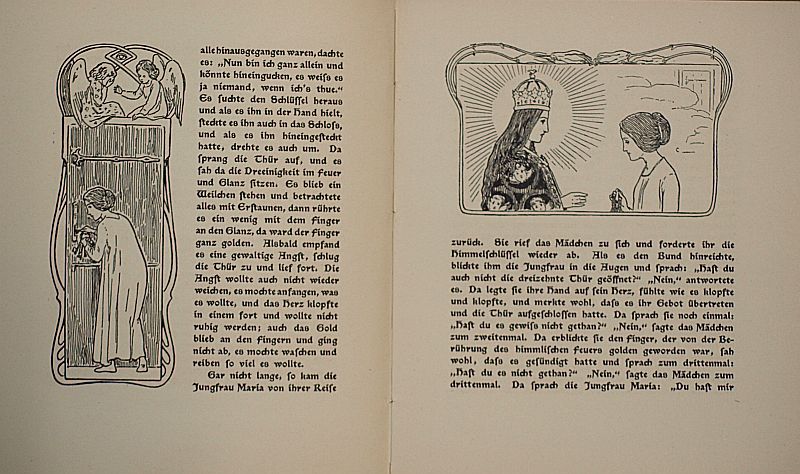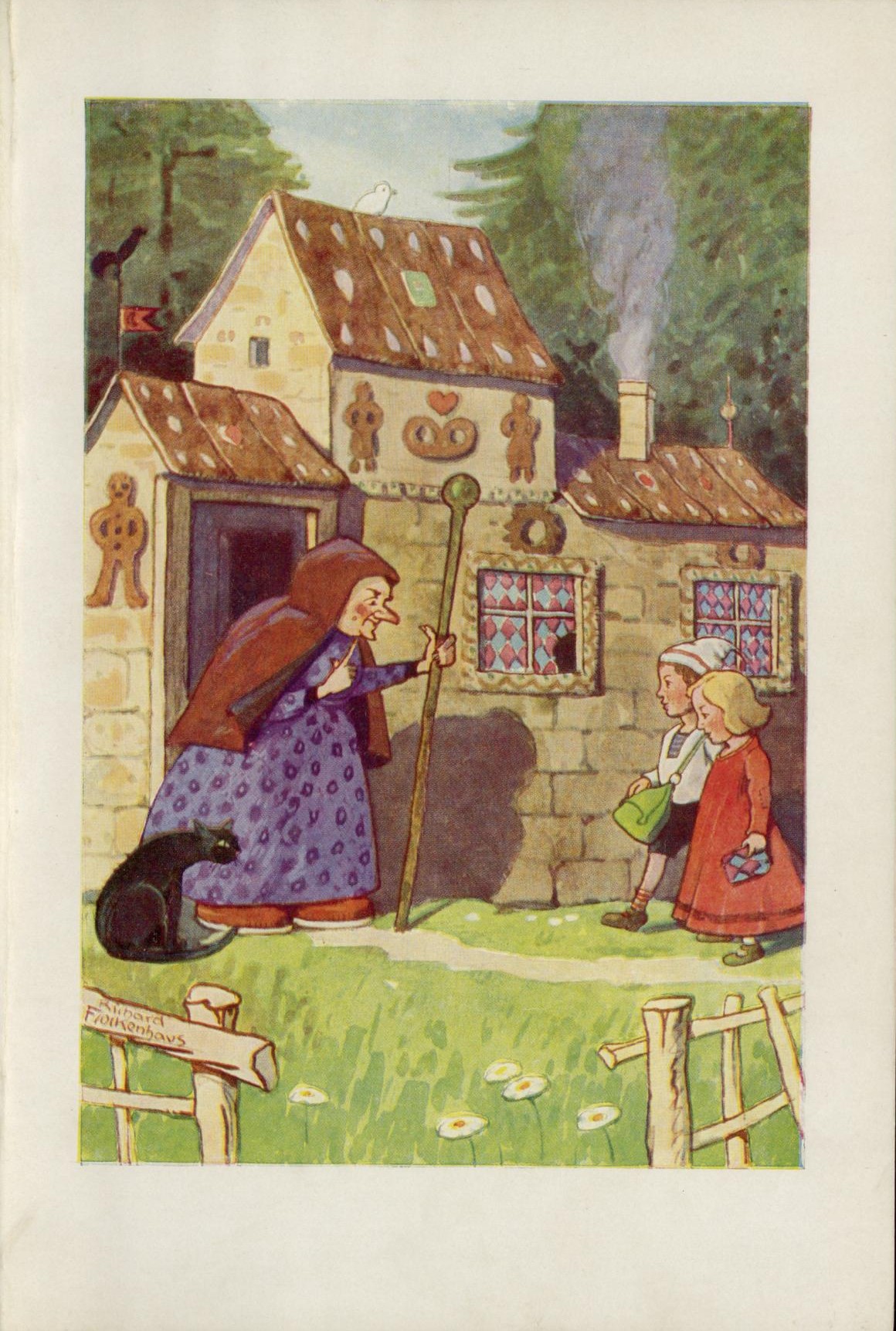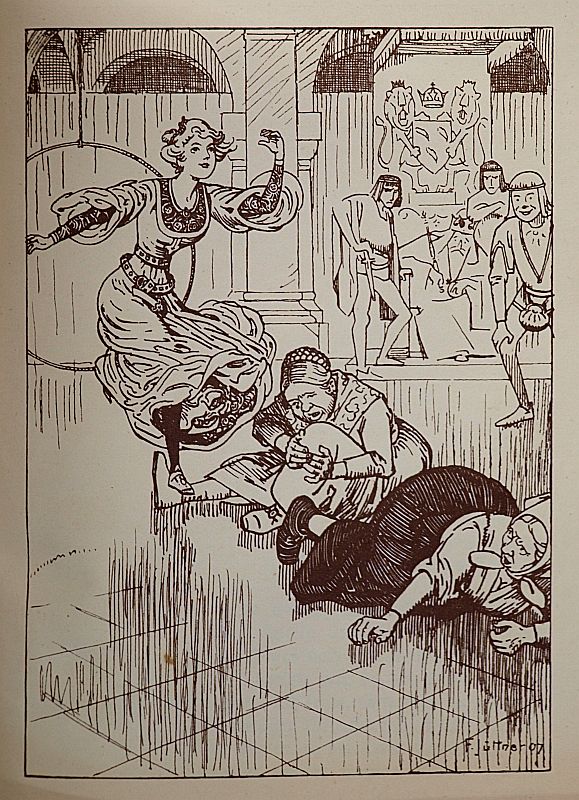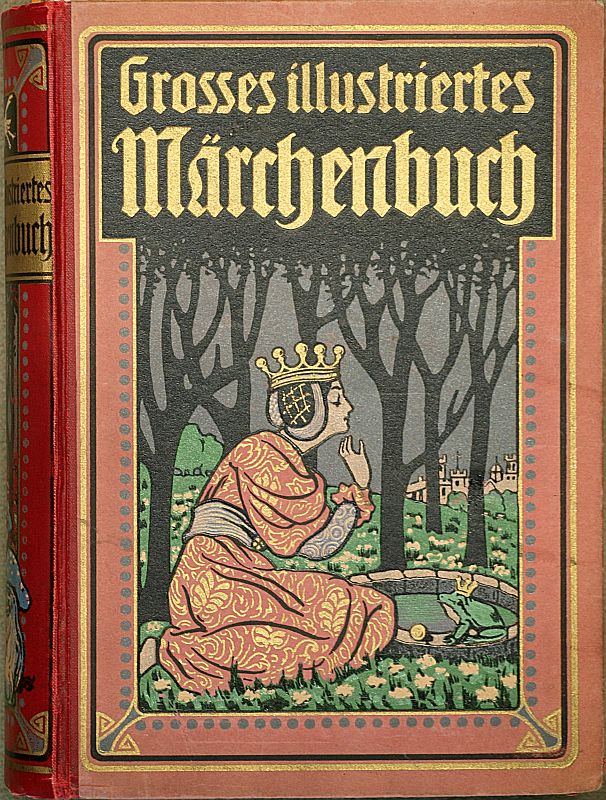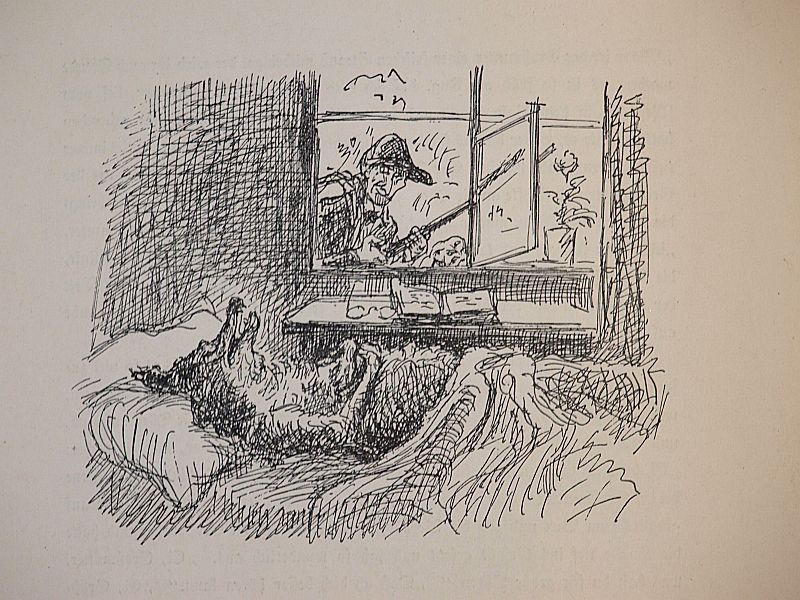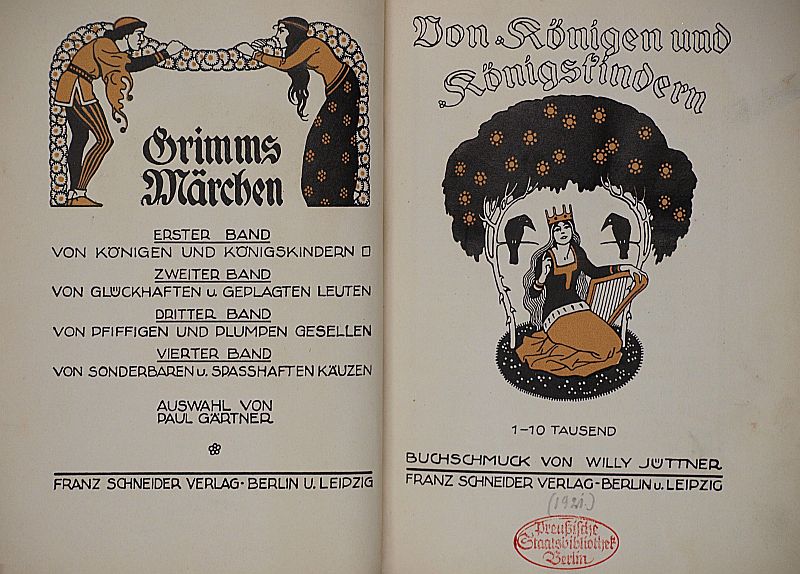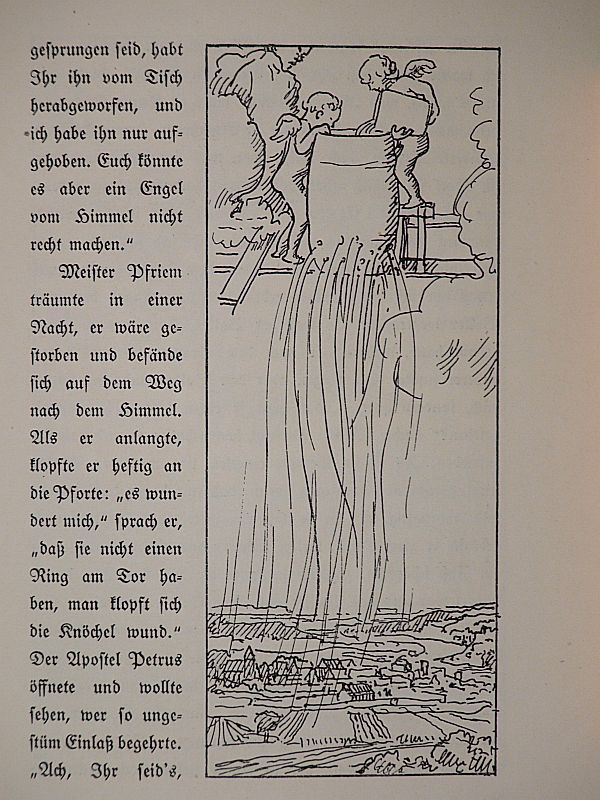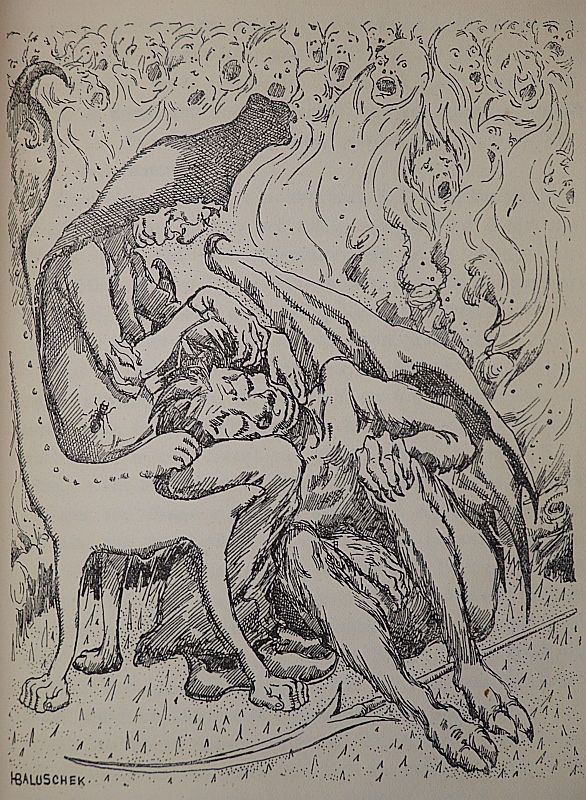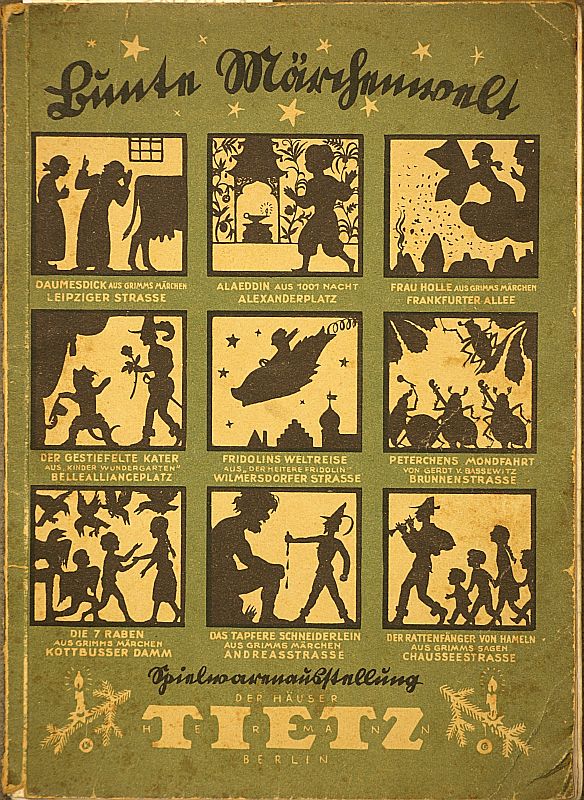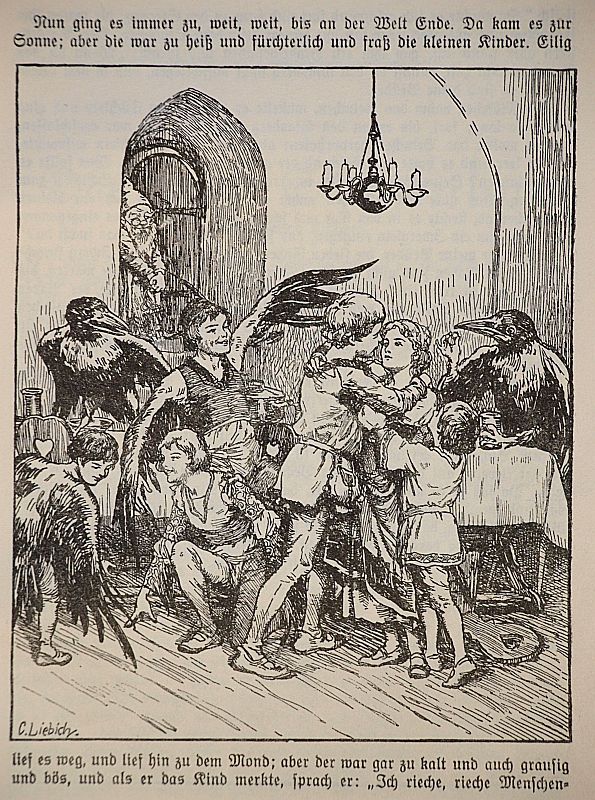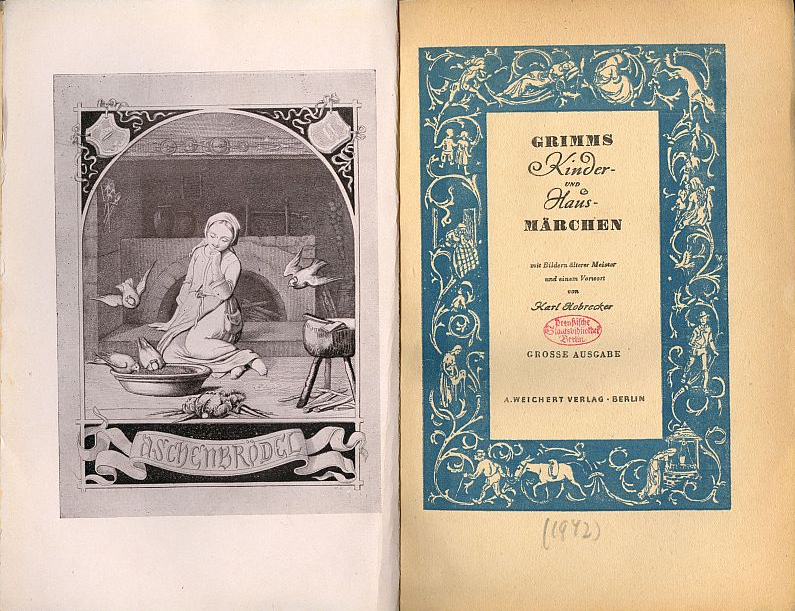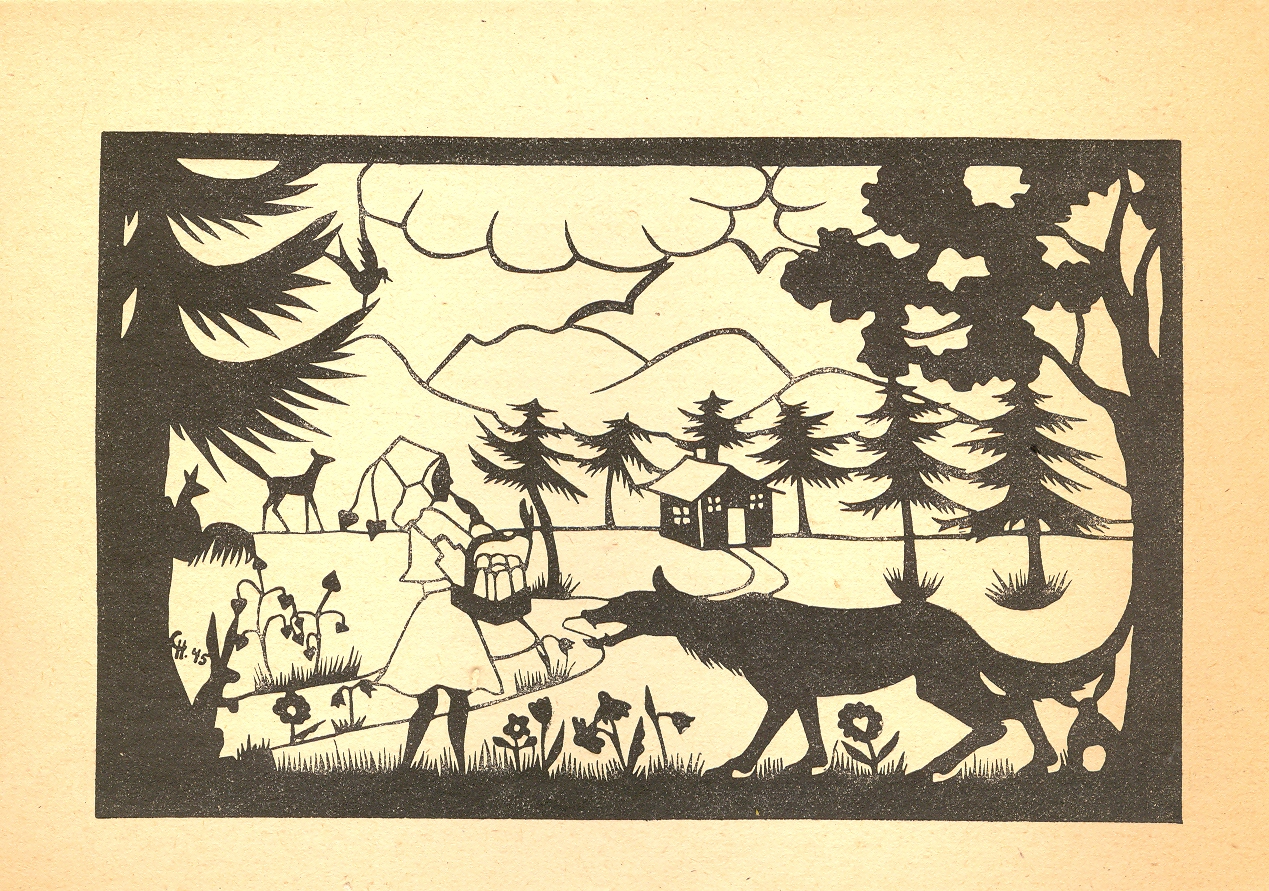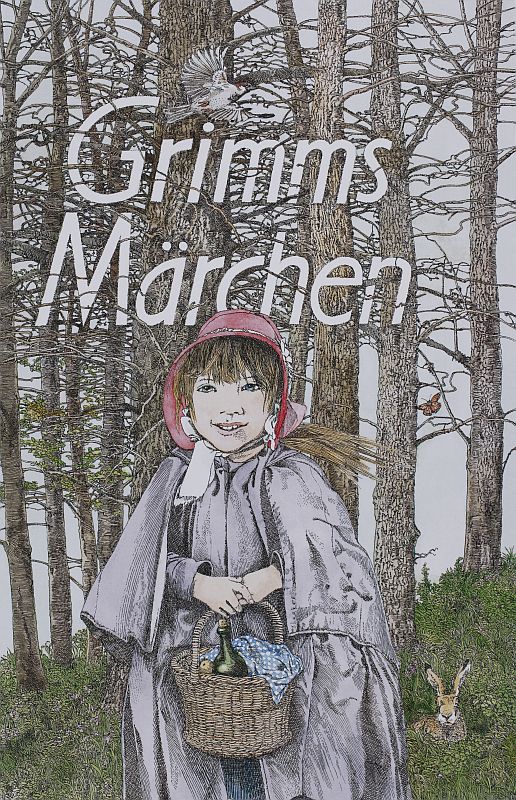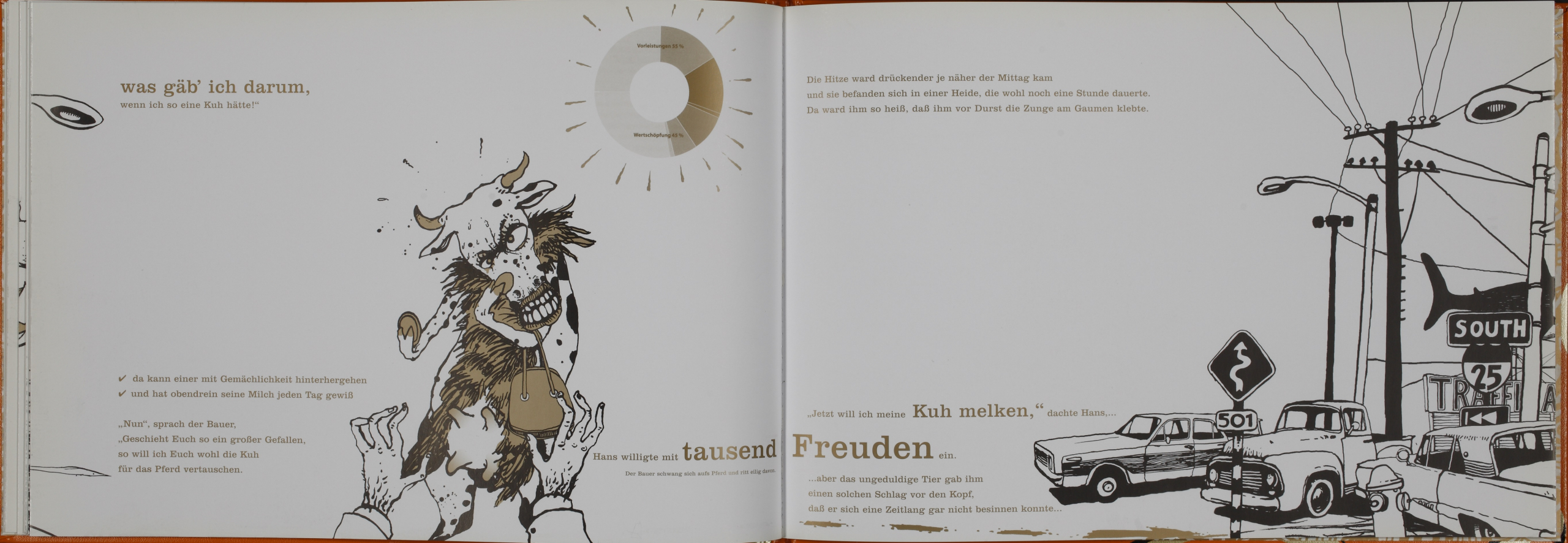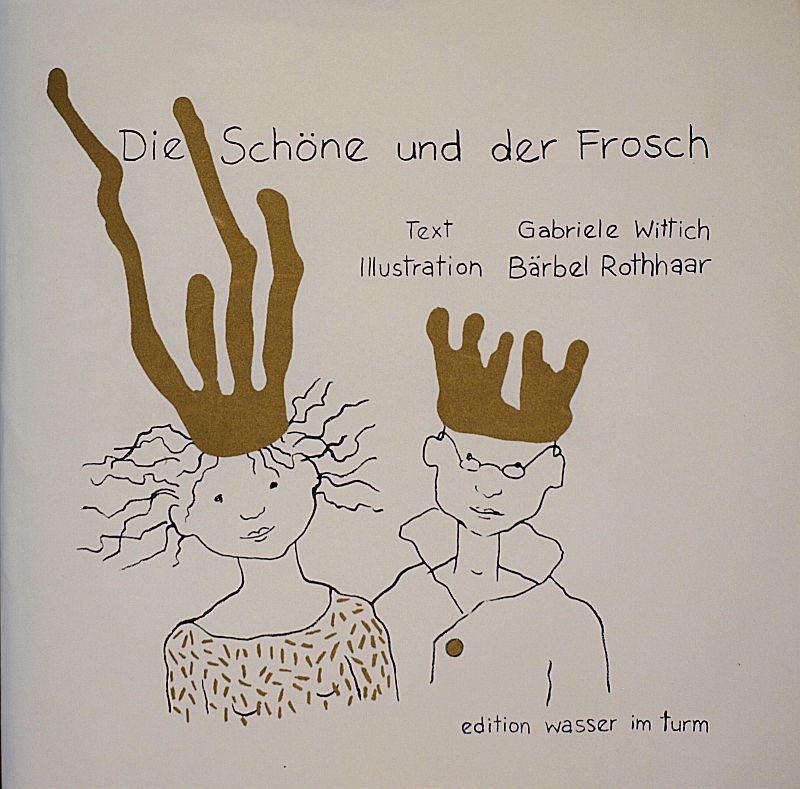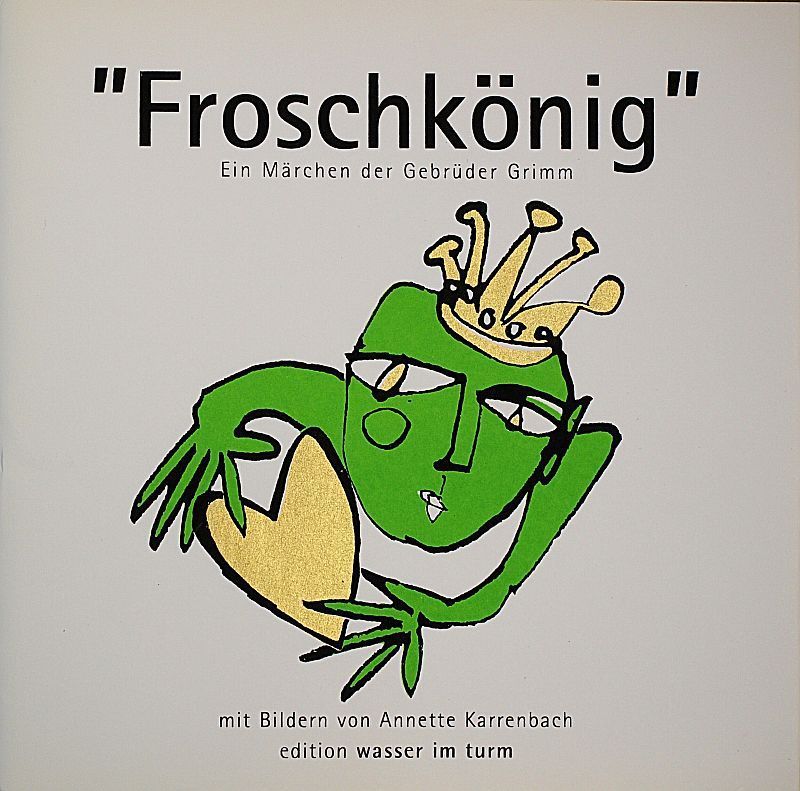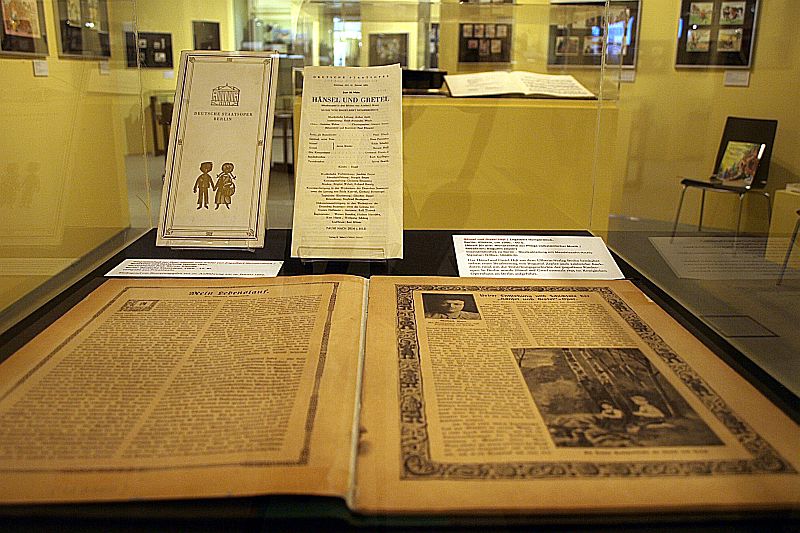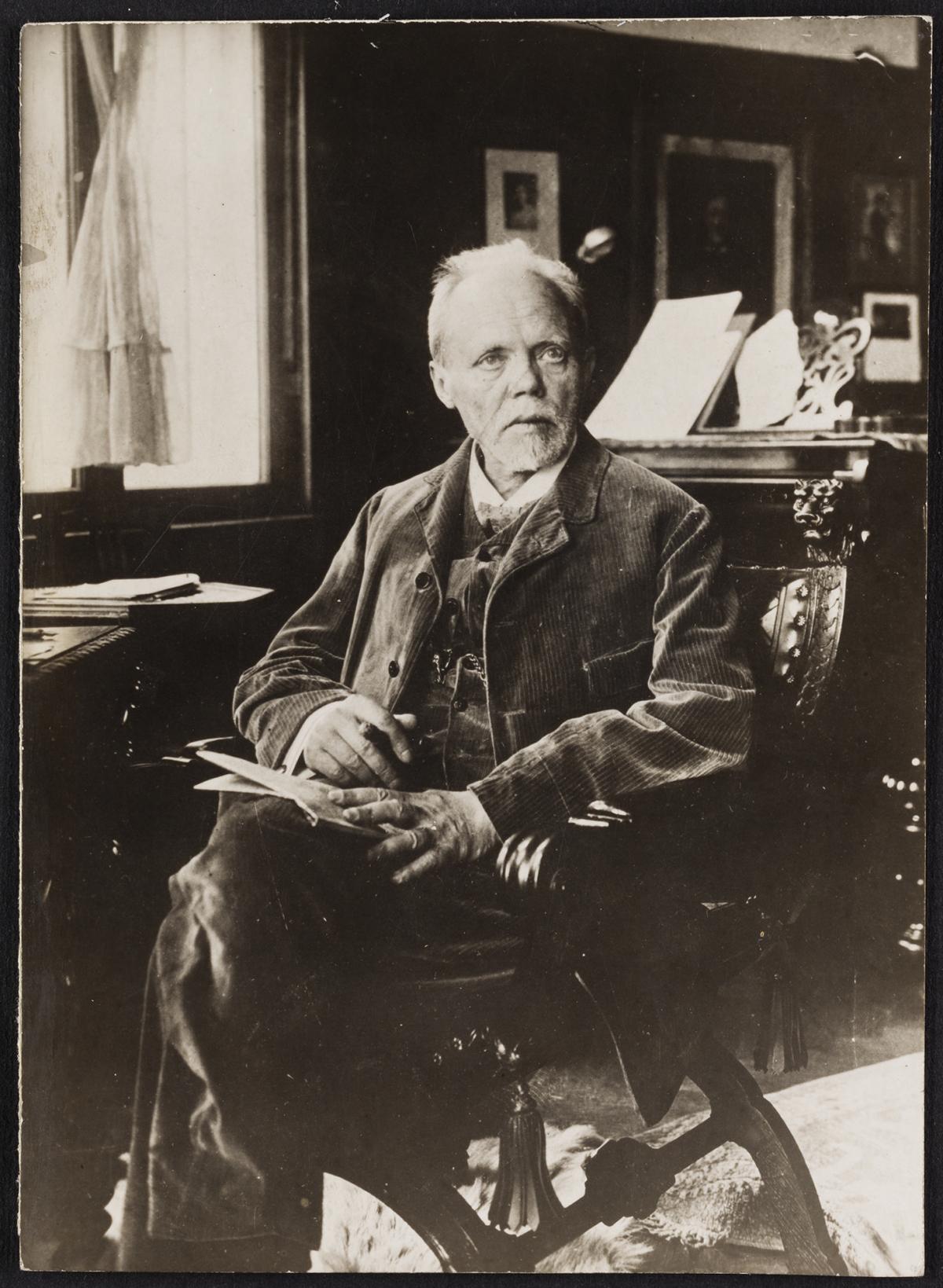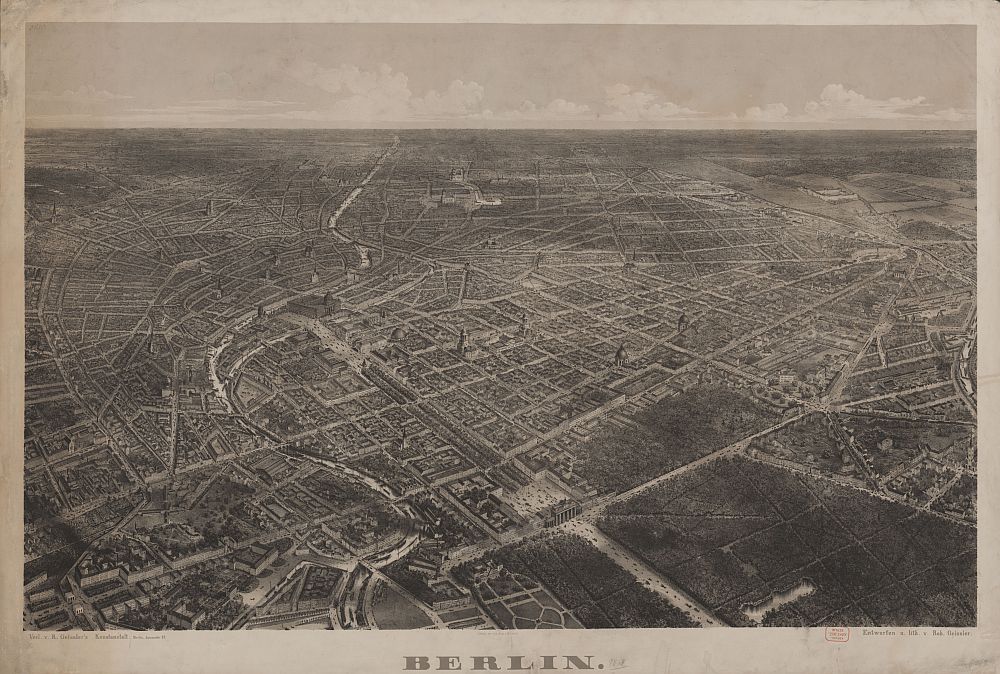Vor 200 Jahren wurden die Kinder- und Hausmärchen von Jacob und Wilhelm Grimm erstmals in Berlin veröffentlicht. Ausgehend vom Berliner Erstdruck hat sich die Sammlung in der ganzen Welt verbreitet. Sie wurde in über 160 Sprachen übersetzt und gehört noch heute zum Kanon der deutschsprachigen Literatur.
Die Ausstellung „Rotkäppchen kommt aus Berlin!“ zeigt alle zu Lebzeiten der Brüder Grimm erschienenen deutschsprachigen Editionen der Großen Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen – von der Erstausgabe 1812 bis zur 1857 in Göttingen publizierten „Ausgabe letzter Hand“ – sowie eine breite Auswahl in Berlin erschienener Drucke vom späten 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Eine Auswahl von Bänden aus der Privatbibliothek von Jacob und Wilhelm Grimm sowie eine Reihe wertvoller handschriftlicher Dokumente geben einen Einblick in das Leben und Wirken der Brüder Grimm in Berlin. Darüber hinaus weist die Ausstellung auf Originalvorlagen zu Berliner Märchenausgaben von mehr als 30 Künstlern hin, berichtet über Berliner Theater- und Operninszenierungen nach Stoffen der Kinder- und Hausmärchen und geht den Spuren der Märchen im Berliner Stadtbild nach. – Soweit urheberrechtlich möglich, werden die Exponate der analogen Ausstellung auch im Rahmen dieser virtuellen Variante gezeigt.
Die Ausstellung war ein Gemeinschaftsprojekt der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, der Arbeitsstelle Grimm-Briefwechsel am Institut für deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin sowie von MÄRCHENLAND – Deutsches Zentrum für Märchenkultur und gehörte zum Programm der 23. Berliner Märchentage 2012. Sie wurde vom 9. November 2012 bis zum 5. Januar 2013 im Ausstellungsraum der Staatsbibliothek zu Berlin, Potsdamer Straße 33 gezeigt.
Zur Ausstellung erschien ein Begleitband, der inzwischen leider vergriffen ist.
Aufbau der Ausstellung:
- Aus den Biographien der Brüder Grimm
- Abschnitt I: Die Erstausgabe der Kinder- und Hausmärchen und die Auflagen bis 1857
- Abschnitt II: Berlin als Lebens- und Wirkungsort der Brüder Grimm
- Abschnitt III: Berliner Ausgaben der Kinder- und Hausmärchen nach 1857
- Abschnitt IV: Originalvorlagen zu Berliner Ausgaben der Kinder- und Hausmärchen
- Abschnitt V: Die Kinder- und Hausmärchen in Bearbeitungen für Theater, Oper und Puppenbühne
- Abschnitt VI: Spuren der Brüder Grimm im Stadtbild Berlins
Informationen zur Abbildung
Lazarus Gottlieb Sichling: Jacob und Wilhelm Grimm; Berlin, vor 1854. Stahlstich nach einer Daguerreotypie von Hermann Biow; Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung; Signatur: Nachl. Grimm 693,2.
1798: Kassel
Zur Vorbereitung auf das noch vom Vater gewünschte Jurastudium gehen die Brüder Grimm 1798 an das Lyceum Fridericianum in Kassel.
1802/03: Marburg
Jacob Grimm immatrikuliert sich 1802 an der Universität Marburg. Wilhelm folgt 1803. Prägend ist die Ausbildung durch Friedrich Carl von Savigny, der sie in seinen romantischen Freundeskreis aufnimmt.
1805: Paris
Im Januar 1805 lädt Savigny Jacob Grimm als Helfer beim Quellenstudium nach Paris ein. Während dieser Trennung schließen die Brüder Grimm die Verabredung über ihre Lebensgemeinschaft.
Zur Vorbereitung auf das noch vom Vater gewünschte Jurastudium gehen die Brüder Grimm 1798 an das Lyceum Fridericianum in Kassel.
1805: Kassel
Die Mutter mietet mit den sechs Kindern 1805 eine Wohnung in der Kasseler Marktgasse. Gegenüber lebt die Apothekerfamilie Wild, mit der ein enges Verhältnis entsteht. (Die Apothekertochter Dortchen Wild heiratet Wilhelm Grimm 1825.) 1808 stirbt die Mutter der Brüder Grimm.
Um die Brüder Grimm bildet sich ein Freundschafts- und Lesezirkel. Hier beginnen sie mit der Sammlung ihrer Märchen. 1807 macht Napoleon Kassel zur Hauptstadt des „Königreichs Westphalen“ mit seinem Bruder Jérôme als König. Jacob Grimm wird dessen Bibliothekar im Schloss Wilhelmshöhe, damals „Napoleonshöhe“. 1811 erscheinen die ersten eigenen Bücher der Brüder Grimm, 1812 mit dem althochdeutschen Hildebrandlied das erste gemeinsame Werk und im Dezember Band 1 der Märchen.
1814/15: Kassel
1814/1815–1829 arbeiten die Brüder Grimm an der Kurfürstlichen Bibliothek in Kassel. Der Dienst lässt ihnen Zeit für eigene Arbeiten. Die reichhaltigen Bestände können sie dafür nutzen. Ab 1819 wird Jacob Grimm mit seiner Deutschen Grammatik in Europa und Nordamerika bekannt. 1829 werden die Brüder Grimm nach Göttingen berufen.
1830: Göttingen
1830–1837: Als Bibliothekare und Professoren an der Universität Göttingen sollen die Brüder Grimm eine Modernisierung der berühmten Universitätsbibliothek bewirken und halten Vorlesungen über die frühe deutsche Sprach-, Literatur- und Kulturgeschichte. Durch politische Entwicklungen des Jahres 1837 (Protest der „Göttinger Sieben“ gegen die Aufhebung der hannoverschen Landesverfassung durch den neuen König Ernst August) müssen sie die Universität unerwartet wieder verlassen.
1837: wieder Kassel
1837–1841 sind die Brüder Grimm ohne Anstellung. Der Landesverwiesene Jacob Grimm geht gleich nach Kassel, Wilhelm folgt ein Jahr später. In diese Zeit fällt die Vereinbarung mit der Weidmann’schen Buchhandlung über das Deutsche Wörterbuch, durch die man die Brüder Grimm materiell sicherstellen und ihre Kompetenz für ein monumentales wissenschaftliches Werk nutzen will, das ein Symbol bürgerschaftlichen Engagements für ein künftiges geeintes, freiheitliches Deutschland sein soll.
1840: schließlich Berlin
Im Herbst 1840 lässt der neue preußische König Friedrich Wilhelm IV. die Brüder Grimm nach Berlin berufen und gewährt ihnen ein gemeinsames Gehalt aus seinen Privatmitteln, mit dem sie frei ihren wissenschaftlichen Arbeiten nachgehen sollen. Als Mitglieder der Königlichen Akademie der Wissenschaften sind sie berechtigt, an der Universität Vorlesungen zu halten, was Jacob bis 1848 und Wilhelm bis 1852 wahrnimmt. 1841–1846 wohnt die Familie am Rand des Tiergartens in der kurz vorher angelegten Lennéstraße, 1846/1847 näher zu Akademie, Universität und Bibliothek in der Dorotheenstraße und ab 1847 in der Linkstraße, unmittelbar am damaligen Potsdamer Bahnhof. Fast täglich haben die Grimms in ihrer Wohnung Gäste. Im Sommer unternehmen sie meist ausgedehnte Reisen. Jacob Grimm fügt seinen Hauptwerken noch die Geschichte der deutschen Sprache (1848) hinzu. 1848 ist er Abgeordneter der Nationalversammlung, tritt im Herbst jedoch aus Unzufriedenheit über den Verlauf der parlamentarischen Arbeit zurück. Die 1850er Jahre sind durch die Arbeit am Deutschen Wörterbuch gekennzeichnet. Jacob Grimm arbeitet A, B und C aus, Wilhelm Grimm folgt mit dem D, und Jacob übernimmt wiederum E und F. Wilhelm Grimm vollendet gerade noch das D, ehe er im Dezember 1859 stirbt. Jacob Grimm gelangt bis zu seinem Tod im September 1863 bis zum Stichwort „Frucht“.
Nach der Beteiligung am Protest der „Göttinger Sieben“ hatten die Brüder Grimm 1837 ihre Professuren in Göttingen verloren. Freunde von Jacob und Wilhelm Grimm, darunter Bettina von Arnim, Friedrich Carl von Savigny und Alexander von Humboldt, setzten sich nachdrücklich für ihre Berufung nach Berlin ein. Diese erfolgte 1841 dank der Unterstützung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV., der den Brüdern aus seinem Privatvermögen eine Pension für ihre Arbeit am Deutschen Wörterbuch aussetzte.
Berlin war ein wichtiger Wirkungsort der beiden Gelehrten, ihr wissenschaftliches Betätigungsfeld hatten sie an der Akademie der Wissenschaften und an der Berliner Universität. Die Königliche Bibliothek war für die Brüder ein vertrauter Studien- und Arbeitsort, hier fanden sie wichtige Quellen für ihre sprach- und kulturhistorischen Forschungen. Mit zwei handschriftlichen Zeugnissen weist die Ausstellung auf die Verbindung der Grimms zur Königlichen Bibliothek hin: einem Leihschein von Wilhelm Grimm und einem Brief von Jacob Grimm an den Oberbibliothekar Georg Heinrich Pertz.
Den Schwerpunkt der wissenschaftlichen Tätigkeit von Jacob und Wilhelm Grimm in den Berliner Jahren bildete die Arbeit am Deutschen Wörterbuch. Außerdem widmeten sich beide Brüder der Fortsetzung und Überarbeitung bereits begonnener Projekte: Jacob Grimm publizierte 1843 eine zweite Auflage der Deutschen Mythologie, der 1854 eine dritte folgte, und (ebenfalls 1854) eine zweite Ausgabe der Deutschen Rechtsaltertümer, Wilhelm Grimm war intensiv mit der Überarbeitung der Kinder- und Hausmärchen beschäftigt. Anfang der 1840er Jahre erreichte die Popularität der Märchen ihren ersten Höhepunkt. Die Abstände zwischen den Ausgaben verkürzten sich, jede Neuauflage der Großen Ausgabe wurde von Wilhelm Grimm „vermehrt und verbessert“ herausgegeben.
Berlin war die letzte Lebensstation der Brüder – 1859 starb Wilhelm Grimm, sein Bruder Jacob überlebte ihn um vier Jahre. Ihre Grabstätte liegt auf dem Schöneberger St.-Matthäus-Friedhof. Die private Handbibliothek der Brüder Grimm wurde von der Berliner Universität übernommen und gehört heute zum Bestand der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin. Eine Auswahl von Büchern aus dieser Sammlung, die eng mit der Arbeit an den Kinder- und Hausmärchen verbunden ist, wird in der Ausstellung gezeigt. Der schriftliche Nachlass der Brüder Grimm wird in der Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin verwahrt. Einige ausgewählte handschriftliche Zeugnisse bilden den wertvollsten Teil dieser Ausstellung – darunter eines der Tagebücher Wilhelm Grimms und Jacob Grimms anrührende Gedenkrede auf seinen Bruder Wilhelm. Private Leihgaben von Nachkommen der Familie Grimm, die ursprünglich aus dem Besitz der Brüder stammten, wie die Lupe von Jacob Grimm, ein Siegelring und eine Tasse von KPM, ergänzen die Auswahl von Lebenszeugnissen. Diese Familienbestände werden erst jetzt für museale Zwecke zugänglich gemacht.
Exponate
Bücher aus dem persönlichen Besitz der Brüder Grimm
Die in diesem Teil der Ausstellung gezeigten Bücher stammen aus der Arbeitsbibliothek der Brüder Grimm. Die Bibliothek wurde – dem Wunsch Jacob Grimms entsprechend – 1865 von seinen Erben an die Friedrich-Wilhelms-Universität (die heutige Humboldt-Universität zu Berlin) verkauft. Aus dem ca. 5.500 Bände umfassenden Bestand wurden für die Ausstellung 24 Titel ausgewählt, die in Zusammenhang mit der Arbeit an den Kinder- und Hausmärchen stehen. Einige der Bände enthalten handschriftliche Notizen der Brüder Grimm. Ein kleiner Teil der Büchersammlung von Jacob und Wilhelm Grimm wurde von der Königlichen Bibliothek (der heutigen Staatsbibliothek zu Berlin) übernommen. Die Bände Frau Holle und Deutsche Hausmärchen stammen aus dem Bestand der SBB.
Die Kommentare verfasste Dr. Berthold Friemel, Leiter der Arbeitsstelle Grimm-Briefwechsel an der Humboldt-Universität zu Berlin
Einzelne Exponate 1 - 9
1. Miscellanea, Oder Allerley zusammen getragene Politische, Historische, und andere denckwürdige Sachen: so zu deß Autoris vorhin außgegangenem Handbuch, als eine Vermehrung, Anhang oder gleichsam Dritter Theil, können nutzlichen gebraucht werden / Martin Zeiller.
Nürnberg: Georg Wild Eisens, 1661. – 14, 608, 22 S.
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: A 10030
Mit Notizen von Jacob und Wilhelm Grimm.
Zeillers Anekdotensammlung ist Quelle für die befremdliche Erzählung Wie Kinder Schlachtens miteinander gespielt haben in der Erstausgabe der Kinder- und Hausmärchen. Kinder ahmen ihren Vater nach, der ein Schwein geschlachtet hat. Ein Kind tötet das andere. Die Mutter tötet zur Strafe das erste. Ein drittes Kind ertrinkt währenddessen im Badezuber. Aus Verzweiflung erhängt sich die Mutter. Der Vater stirbt kurz darauf aus Betrübnis. Die Geschichte scheint dem Märchenbegriff der Brüder Grimm nicht zu entsprechen, aber sie war ihnen schon von der eigenen Mutter erzählt worden. Der Druck bei Zeiller galt ihnen als Beleg hohen Alters dieses auch später noch verbreiteten Erzähltyps.
2. Die Sagen und Volksmärchen der Deutschen / Friedrich Gottschalck.
Halle: Hemmerde und Schwetschke.
Bd. 1. 1814. – XXXVI, 356 S. : Illustrationen.
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: Yk 481-1
Mit Notizen von Jacob und Wilhelm Grimm.
Gottschalcks Sammlung enthält nach Grimm’schem Begriffsverständnis keine Märchen, sondern Sagen im engeren Sinn (wie z. B. Der Hexentanz auf dem Brocken, Das Oldenburg’sche Wunderhorn, Der Ausgang der Hameln’schen Kinder). In der Vorrede zu den Deutschen Sagen der Brüder Grimm (1816) heißt es: „Das Märchen ist poetischer, die Sage historischer; jenes stehet beinahe nur in sich selber fest, in seiner angeborenen Blüte und Vollendung; die Sage, von einer geringern Mannichfaltigkeit der Farbe, hat noch das Besondere, daß sie an etwas Bekanntem und Bewußtem hafte, an einem Ort oder einem durch die Geschichte gesicherten Namen“. Vor der Präzisierung durch die Brüder Grimm wurden die Wörter Märchen und Sage weitgehend synonym verwendet.
3. Almanach deutscher Volksmährchen / Hermann Kletke. Mit Zeichnungen von Theodor Hosemann.
Berlin: Morin, 1840. – XI, 292 S. : Illustrationen.
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: Yk 661
4. Deutsche Hausmärchen / herausgegeben von Johann Wilhelm Wolf.
Göttingen: Dieterich ; Leipzig: Vogel, 1851. – XVI, 439 S.
Staatsbibliothek zu Berlin
Signatur: Yt 1860
Mit Notizen von Wilhelm Grimm.
Wolfs Märchensammlung ist die erste, die mit der Grimm’schen das (von einer Formulierung Georg Rollenhagens aus dem Jahr 1595 inspirierte) Wort „Hausmärchen“ im Titel teilt. Wilhelm Grimm verglich das Exemplar, das er von Wolf als Geschenk erhielt, mit der eigenen Sammlung und brachte die Ergebnisse des Vergleichs in die neue Auflage des Anmerkungsbandes (1856) ein. Wolfs Sammlung geht zu großen Teilen auf die Befragung von Soldaten nach Märchen und Sagen zurück. Das ausgestellte Handexemplar wurde bei den Vorbereitungen für unsere Ausstellung in den Beständen der Staatsbibliothek ermittelt.
5. Volks-Sagen, Märchen und Legenden / Johann Gustav Gottlieb Büsching.
Leipzig: Reclam.
Bd. 1. 1812. – XXVIII, 210 S. : Illustrationen.
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: Yk 355-1
Mit Notizen von Jacob und Wilhelm Grimm.
Büschings Märchenbuch erschien einige Monate vor dem der Brüder Grimm. Dem damals modernen romantischen Bedürfnis nach Sammlungen von Märchen und Sagen entsprach Büsching mit umfangreichen Auszügen aus historischen Werken, Chroniken, Reisebeschreibungen, genealogischer Literatur usw., bei denen es sich nach der Begriffsverwendung der Brüder Grimm meist um Sagen handelt, da sich die Erzählungen auf Personen oder Orte der Geschichte beziehen. An mündlicher Überlieferung sei er sehr arm, so Büsching. Jacob Grimm zog das Buch für die Deutschen Sagen (1816/1818) heran, wovon Benutzungsspuren zeugen. Einfluss auf die Kinder- und Hausmärchen hatte es nicht. Durch Anstreichungen und Notizen im Vorwort machten die Grimms sich über Büsching lustig.
6. Frau Holle: ein hessisches Volksmärchen / Herausgeber: Karl Christoph Schmieder.
Kassel: Bohné, 1819. – IV, 72 S.
Staatsbibliothek zu Berlin
Signatur: Yt 2950
Mit Notizen von Jacob Grimm.
Der Gymnasialprofessor Schmieder war wie die Brüder Grimm ein Kasseler Schriftsteller, vorwiegend als Naturwissenschaftler und Numismatiker. Ob er das ausgestellte Frau-Holle-Buch als Satire verstanden wissen wollte, bleibt unklar. In frei erfundener romanhafter Darstellung werden Geschichten um eine Frau Holle erzählt. Sie sei angeblich die Tochter des Stammvaters von Diederode gewesen, eines am hessischen Meißner-Berg gelegenen Dorfes. Die Geschichten seien „theils auf dem Berge, theils in den Orten umher“ gesammelt. Jacob Grimm protestierte in einer Rezension, deren bibliographische Daten er auch auf dem Titelblatt des ausgestellten Handexemplars notierte. Es wurde bei den Vorbereitungen für unsere Ausstellung in den Beständen der Staatsbibliothek ermittelt.
7. Das Märchen vom gestiefelten Kater in den Bearbeitungen von Straparola, Basile, Perrault und Ludwig Tieck / mit 12 Radierungen von Otto Speckter.
Leipzig: Brockhaus, 1843. – 112 S.
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: Xb 17210
8. Hundert neue Mährchen im Gebirge gesammelt / Friedmund von Arnim.
Charlottenburg: Bauer.
Bd. 1. 1844. – 136 S.
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: Yk 701-1
9. Alte und neue Kinder Lieder: mit Bildern und Singweisen / Franz von Pocci ; Karl von Raumer.
Leipzig: G. Mayer, 1852. – 48 S.
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: Nz 33539
Einzelne Exponate 10 - 18
10. Österreichische Volksmärchen / Franz Ziska.
Wien: Armbruster, 1822. – VI, 110 S.
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: Yk 9101
11. Contes populaires, préjugés, patois, proverbes, noms de lieux, de l’arrondissement de Bayeux / Frédéric Pluquet. – 2. Éd.
Rouen: Frére, 1834. – XIII, 159 S.
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: Xu 361612
12. Il pentamerone / Giambattista Basile.
Napoli: Porcelli.
Bd. 1. 1788. – 371 S.
Bd. 2. 1788. – 348 S.
(Collezione di tutti i poemi in lingua Napoletana ; 20 ; 21)
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: Xn 26282-1a und Xn 26282-2 a
Mit Notizen von Jacob und Wilhelm Grimm.
Ursprünglich sollten die Kinder- und Hausmärchen nicht auf deutsche Märchen beschränkt bleiben. Die Brüder Grimm wollten im zweiten Band Basiles Pentamerone, „ein in Italien eben so bekanntes und beliebtes, als in Deutschland seltenes und unbekanntes, … in jeder Hinsicht vortreffliches Buch“, verdeutschen, „worin auch alles andere, was fremde Quellen gewähren, seinen Platz finden soll“ (Vorrede 1812). Die Märchensammlung des neapolitanischen Hofdichters Basile (1575–1632) war der wichtigste Vorläufer für die Sammlung der Grimms. Im Anmerkungsband von 1822 erzählten sie den Pentamerone auf über 100 Seiten nach. Hierfür benutzten sie die ausgestellte Ausgabe, wie sie ausdrücklich erwähnten. Zahlreiche Bleistiftnotizen Wilhelm Grimms zeigen sein Bemühen um Details des neapolitanischen Dialekts.
13. Feen-Mährchen / Antoine Hamilton.
Gotha: Ettinger, 1790. – X, 512 S.
(Die blaue Bibliothek aller Nationen ; 2)
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: Xb 10188
14. Songs for the nursery, collected from the works of the most renowned poets, and adapted to favourite national melodies.
London: Darton, 1818. – 59 S.
Mit vielen handschriftlichen Bemerkungen von ‘Edgar Taylor, Temple, London 26 Dec. 1822’. Zum Titel ‛Works of the most renowned poets’: ‛This of course is a joke’.
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: Za 52155
15. Traditional tales of the English and Scottish peasantry: in two volumes / Allan Cunningham.
London: Taylor and Hessey, 1822.
Vol. 1. – X, 322 S.
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: Za 56201-1
16. H. C. Andersen’s gesammelte Werke: das Märchen meines Lebens / Hans Christian Andersen.
Leipzig: Lorck.
1. 1847. – 122 S. : Illustrationen.
2. 1847. – 159 S.
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: Zk 46044:1-2
Hans Christian Andersen ist bis heute wie die Brüder Grimm durch seine Märchen (wie Die Schneekönigin, Die kleine Meerjungfrau, Die Prinzessin auf der Erbse) bekannt. Anders als die Brüder Grimm erfand er diese Märchen selbst, ließ sich allerdings von Volksmärchen anregen. In seiner Autobiographie Das Märchen meines Lebens erzählt Andersen, dass Jacob Grimm ihn nicht gekannt habe, als er ihn ohne Empfehlungsschreiben unangemeldet in Berlin besuchte. Wilhelm Grimm habe Andersen bei einer späteren Gelegenheit gesagt: „Ich hätte Sie doch wohl gekannt, wenn Sie zu mir gekommen wären, als Sie das letzte Mal hier waren“. Andersens Bücher in der Bibliothek der Brüder Grimm enthalten keine Notizen von ihnen.
17. Norske Folkeeventyr / Peter Christen Asbjørnsen ; Jørgen Engebretsen Moe. – 2., forøgede udg.
Christiania: Dahl, 1852. – LXVIII, 502 S.
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: Zk 145632
Asbjørnsen und Moe waren seit ihrer Schulzeit befreundet und reisten gemeinsam durch Norwegen, um die dort erzählten Märchen zu sammeln. Die Erstausgabe erschien 1842/1843. Die zweite Ausgabe von 1852 ist den Brüdern Grimm gewidmet. Jacob Grimm unterstützte Asbjørnsen und Moe 1849 mit einem Gutachten, in dem es heißt: „Diese forschungen fallen noch in die rechte stunde und beruhen in dem untriegenden gefühl, dass nicht länger gesäumt werden dürfe auf die rettung dessen bedacht zu nehmen, dem in den nächsten generationen fast gänzlicher untergang droht; die öffentliche aufmerksamkeit richtet gleichsam im letzten augenblick sich hin zu der stelle, an der sie vorher immer gleichgültig vorübergegangen war“. Asbjørnsens Name ist auch mit einer erfolgreichen Initiative zum Schutz der norwegischen Wälder verbunden. Er war ausgebildeter Zoologe.
18. Russische Volksmärchen / in den Urschriften gesammelt und ins Deutsche übersetzt von Anton Dietrich. Mit einem Vorwort von Jacob Grimm.
Leipzig: Weidemann, 1831. – XXIV, 312 S.
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: Zn 13831
Mit Notizen von Jacob und Wilhelm Grimm.
In seinem Vorwort spricht sich Jacob Grimm dagegen aus, die Verwandtschaft europäischer Märchen vorwiegend aus literarischer Entlehnung zu erklären: „Man weiß, daß bei Franzosen und Italienern fast die nämlichen im Gange gewesen sind, die bei uns Deutschen fortleben, weniger bekannt geworden ist, was die Spanier besitzen. Und doch hat keins dieser Völker in der Regel das seinige unmittelbar aus dem Eigenthum des andern entlehnt, meistentheils erscheint, neben der Einstimmung im Ganzen, ein eigenthümliches nationales Gepräge, das an den einzelnen Erzählungen grade gefällt, und über ihrer Verbreitung schwebt ein Dunkel, wie bei der Sprache und alten Dichtung insgemein“.
Einzelne Exponate 19 - 27
19. Das Mährchen von Iwan Zarewitsch & dem grauen Wolf / von Vasilij Andreevič Žukovskij. Mit einem Vorwort von Justinus Kerner.
Stuttgart: Hallberger, 1852. – XII, 88 S.
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: Zn 27100
20. Groß-Polens Nationalsagen, Mährchen und Legenden und Lokalsagen des Großherzogthums Posen / herausgegeben von San-Marte.
Brombert: Levit.
Heft 1. 1842. – 328 S.
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: Zo 53140
21. Narodne srpske pripovijetke / Vuk S. Karadžić.
U Beću, 1821. – 48 S.
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: Zq 47130
Der mit den Brüdern Grimm befreundete Philologe und Sammler von Volksliedern und Märchen Vuk Stefanović Karadžić war fast gleichaltrig mit ihnen. In der serbischen Kulturgeschichte hat Karadžić eine ähnliche Bedeutung wie Luther und die Brüder Grimm zusammengenommen in der deutschen. Er übersetzte das Neue Testament ins Serbische, schrieb ein serbisches Wörterbuch und eine serbische Grammatik. Letztere (1814) wurde von Jacob Grimm ins Deutsche übersetzt (1824). Zur Übersetzung von Karadžićs Volksmärchen der Serben (1854), deren schmale Erstausgabe von 1821 ausgestellt wird, schrieb Grimm eine Vorrede, die mit den Worten beginnt: „Keine kleine freude macht es mir, das neueste werk meines berühmten freundes, zu welchem ich selbst ihm schon vor dreiszig jahren den ersten antrieb gegeben hatte, mit einer vorrede zu begleiten“.
22. Magyarische Sagen und Mährchen / Johann Mailáth.
Brünn: Trassler, 1825. – 281 S.
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: Zr 98825
23. Walachische Mährchen: mit einer Einleitung über das Volk der Walachen ; nebst einem Anhang zur Erklärung der Mährchen / Arthur Schott und Albert Schott.
Stuttgart [u.a.]: Cotta, 1845. – XV, 384 S.
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: Xh 79160
Mit Notizen von Jacob und Wilhelm Grimm.
Die Märchen wurden im Banat (Rumänien) gesammelt. Auf dem Vorsatzblatt notierte Wilhelm Grimm mit Bleistift: „die märchen sind mannigfaltig wie die deutschen, ein theil stimmt mit diesen überein. schade daß der märchenton nicht getroffen ist“. Über eine Figur fügte er hinzu: „Bakâla wie das deutsche bürle dumm u. listig, boshaft und gutmütig, falsch und unschuldig / diese vereinigung kommt in der natur vor“. Die Herausgeber schließen sich bis zur Orthographie an die Grimms an – auch darin, dass sie „die schreibart einer schonenden umarbeitung … unterwerfen …, da sich diss, wie das beispiel der brüder Grimm bewiesen hat, mit einer sachgetreuen mittheilung vollkommen verträgt“ (Vorwort). Im rückwärtigen Deckel befindet sich ein ausführliches Inhaltsverzeichnis Wilhelm Grimms.
24. Tausend und eine Nacht: arabische Erzählungen / zum erstemal aus einer Tunesischen Handschrift ergänzt und vollständig übersetzt von Max. Habicht, F. H. vom der Hagen und Karl Schall.
Breslau: Max.
Bd. 1. 1825. – XL, 333 S.
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: Zu 32863-1
25. Die Mährchensammlung des Somadeva Bhatta aus Kaschmir / aus dem Sanskrit ins Deutsche übersetzt von Hermann Brockhaus.
Leipzig: Brockhaus.
Bd. 1. 1843. – XXII, 214 S.
Bd. 2. 1843. – VI, 211 S.
(Sammlung orientalischer Mährchen, Erzählungen und Fabeln ; 1/2
Ausgewählte Bibliothek der Classiker des Auslandes ; 27/28)
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: Zt 10571-1/2
26. Contes chinois / traduits par MM. Davis. Publiés par Abel-Rémusat.
Paris: Moutardier.
Tom. 1. 1827. – XI, 240 S. : Illustrationen.
Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Signatur: Zx 7027-1
Außerdem:
Appenzellischer Sprachschatz / Titus Tobler.
Zürich, 1837. – LVIII, 464 S.
Staatsbibliothek zu Berlin
Signatur: 37 MA 12322
Das von Wilhelm Grimm auf dem beiliegenden Leihschein bestellte und benutzte Exemplar gehört leider zu den Kriegsverlusten der Bibliothek. Der hier ausgestellte Band ist ein Ersatzexemplar.
Weitere Exponate
Porträts und bildliche Darstellungen
Friedrich Wilhelm IV.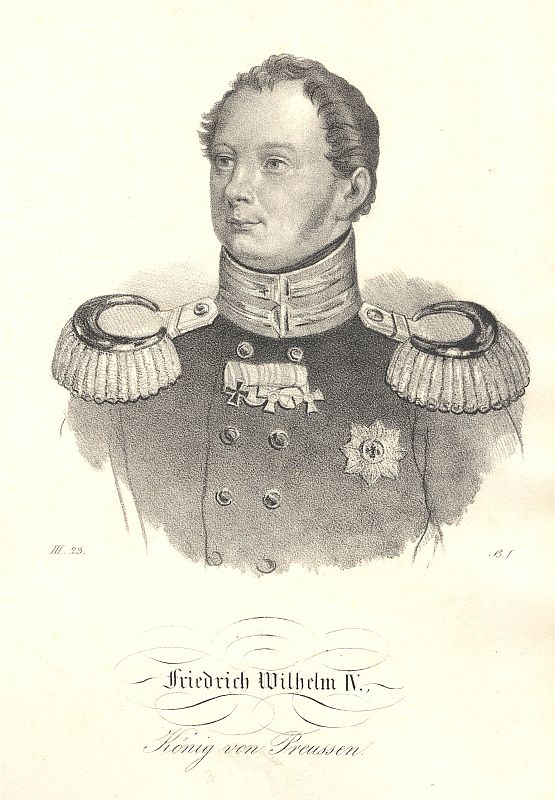
Dresden: Pietzsch, 1842.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Lithographie aus Borussia: Museum für Preußische Vaterlandskunde.
Achim von Arnim.
Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung
Signatur: Lit. m./Arnim, Achim von, ohne Nr.
Märchenfrau mit sechs Kindern / Ludwig Emil Grimm.
Um 1835.
Leihgabe des Museums Haldensleben
Radierung.
Bettine von Arnim mit Goethedenkmal / Ludwig Emil Grimm.
1838.
Leihgabe des Museums Haldensleben
Radierung.
Handschriftliche Dokumente
Jacob Grimm: Entwurf eines Briefes an Johann Albrecht Friedrich Eichhorn.
Kassel, 8.11.1840.
Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung
Signatur: Nachl. Grimm 657, Bl. 39r
Jacob Grimm erklärt in diesem Brief an Kultusminister Eichhorn (1779-1856), dass er und sein Bruder gern den Ruf nach Berlin annähmen und ihre großen Werke der Sprache und Geschichte hier fortsetzen wollen.
(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)
Jacob Grimm: Brief an Georg Heinrich Pertz.
Berlin, 15. August 1846.
Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung
Signatur: Slg. Darmstädter 2 b* 1808 [Jacob Grimm], Bl. 4-6
Jacob Grimm weist in diesem Brief an den Oberbibliothekar der Königlichen Bibliothek Georg Heinrich Pertz (1795–1876) die Anschuldigung zurück, einen Tintenfleck in einem Buch der Bibliothek verursacht zu haben:
„Nicht anders als empfindlich berühren konnte mich ew. hochwolgeboren gefällige zuschrift vom 13 d., welche mir zutraut ein von der königl. bibliothek entliehnes buch besudelt zu haben, der ich 22 jahre öffentlichen bibliotheken vorstand und dem schon dadurch zur natur geworden ist alle bücher aufs sauberste zu halten. Mein dintenfaß hat nur für wenige tropfen raum, und wenn auch manche fehler und irrthümer aus ihm hervorgegangen sind, muß ich es doch freisprechen von aller schuld jemals flecken verursacht zu haben.“
(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)
Wilhelm Grimm: Tagebuchnotiz vom 16.1.1859.
In: Tagebuch 14.9.1857-3.12.1859.
Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung
Signatur: Grimm 151, Heft 4, Bl. 13v/14r
Transkription der handschriftlichen Notiz vom 16. Januar 1859:
„am 16. Januar 1859 ‚Jakob auf dem ordensfest, der Prinz v. Preußen, die princessin von Preußen und der prinz Friedrich Wilhelm haben freundlich mit ihm gesprochen. der feldmarschall Wrangel ist gekommen und hat gefragt, ob er nicht wieder einen band märchen herausgeben wolle'“
(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)
Jacob Grimm: Rede auf Wilhelm Grimm.
Manuskript, 1860.
Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung
Signatur: Nachl. Grimm 1784, S. 1
Am 16. Dezember 1859 starb Wilhelm Grimm. Am 5. Juli des folgenden Jahres hielt Jacob Grimm für den Bruder eine anrührende Gedenkrede in der Akademie der Wissenschaften. Er würdigte nicht nur wissenschaftliche Werk des Bruders, sondern zeigte Übereinstimmungen und Differenzen in der Persönlichkeit wie auch in der Forschung.
Karten und Stadtansichten
Grundriss von Berlin: mit nächster Umgegend 1850 / gezeichnet von Ferdinand Boehm. Gestochen von Carl Jättnig.
Berlin: Reimer, 1850.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kartenabteilung
Signatur: Kart. X 17764
Kolorierter Kupferstich, 56 x 44 cm, 1:12.500.
Auf Papier aufgeklebt. – Mit handschriftlichen Eintragungen. – Aus dem Königlichen Kartographischen Institut Berlin.
(Blattgröße 62,5 x 55 cm)
Die Königl. Academie der Künste an der Lindenpromenade.
Leihgabe aus Privatbesitz
Kolorierter Stahlstich.
Darstellung der Berliner Akademie um 1850.
Die Akademie der Wissenschaften und die Akademie der Künste waren in dieser Zeit im gleichen Gebäudekomplex Unter den Linden untergebracht.
Das Universitaets Gebaeude.
Leihgabe aus Privatbesitz
Kolorierter Stahlstich.
Darstellung der Berliner Universität um 1850.
Die Königliche Bibliothek.
Staatsbibliothek zu Berlin – PK, Handschriftenabteilung
Signatur: Portr. Slg / Bildnisschrank / m 580
Kolorierte Lithographie.
Berlin vom Kreuzberge: umgeben von 22 Teilansichten aus Berlin / kolorierte Lithographie von Ammon.
o.O., ca. 1845.
58,5 x 38,5 cm
Staatsbibliothek zu Berlin – Kartenabteilung
Signatur: Kart. Y 44503
(Blattgröße 62,5 x 42 cm)
Museale Gegenstände aus dem persönlichen Besitz der Brüder Grimm
Tasse und Untertasse mit Blumendekor der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin.
19. Jahrhundert.
Leihgabe der Brüder-Grimm-Platz e. V. Kassel
Tasse und Untertasse stammen aus dem Besitz der Familie Grimm.
Teesieb in Form eines Blütenkelchs mit langem Griff und Füßen zum Abstellen.
Leihgabe der Brüder-Grimm-Platz e. V. Kassel
Das Sieb stammt aus dem Besitz der Familie Grimm.
Pappkästchen mit gedrucktem Etikett.
Berlin: Juwelier C. Schwartz, Mohrenstraße.
Leihgabe aus Privatbesitz
Das Kästchen stammt aus dem Besitz der Familie Grimm.
Leihschein von Wilhelm Grimm aus der Königlichen Bibliothek.
Leihgabe aus Privatbesitz
Wilhelm Grimm bestellte damit in der Königlichen Bibliothek das Buch Appenzellischer Sprachschatz von Titus Tobler mit der Signatur Yb 8630.
Druckstein mit dem Bildnis Jacob Grimms / Zeichnung von Herman Grimm.
Berlin, 1845.
Leihgabe des Museums Haldensleben
Petschaft mit Monogramm „G“ in sechseckigem Stein.
Leihgabe aus Privatbesitz
Das Exponat stammt aus dem Besitz der Familie Grimm.
Siegelring der Hofdame Henriette Philippine Zimmer (Tante der Brüder).
Leihgabe der Brüder-Grimm-Platz e. V. Kassel
Abgedruckt auf einem Brief von Wilhelm an Jacob Grimm vom 2. Juni 1815.
Gold mit bläulichem durchscheinendem Stein. Motiv: Sonne und Vogel in Schild, darüber Krone.
Geldkatze von Jacob Grimm.
Um 1830.
Leihgabe des Museums Haldensleben
Eine sogenannte „Geldkatze“ war eine spezielle Form des Geldbeutels, die am Gürtel befestigt wurde und in der Münzen und kleinere Wertgegenstände aufbewahrt werden konnten.
Brieftasche mit Notizbuch und Kalendarium (Juni 1830), Federmesser mit Beingriff und Bleistift.
Leihgabe aus Privatbesitz
Die Brieftasche stammt aus dem Besitz der Familie Grimm.
Lupe mit kurzem Griff.
Leihgabe aus Privatbesitz
Laut Familienüberlieferung speziell für Jacob Grimm angefertigt und an seine von der Gicht gekrümmten Finger angepasst.
Achatkästchen.
19. Jahrhundert.
Leihgabe der Brüder-Grimm-Platz e. V. Kassel
Laut Familienüberlieferung von Jacob Grimm aus Paris mitgebracht.
1806 hatten Jacob und Wilhelm Grimm mit dem Sammeln der Märchen begonnen. Während eines Besuchs in Kassel im Frühjahr 1812 regte Achim von Arnim die Publikation der Märchen an, und einige Wochen später bat ihn Jacob Grimm, einen geeigneten Verleger zu suchen: „Kannst Du einmal dort einen Verleger zu den von uns gesammelten Kindermärchen bereden, so tu es doch, am Ende tun wir auf Honorar Verzicht und halten es nur für eine mögliche zweite Auflage aus […] .“
Bereits im Juni 1812 kam von Arnim aus Berlin die Nachricht, dass Georg Andreas Reimer die Märchen in seiner Realschulbuchhandlung veröffentlichen lassen wolle. Wenige Monate später, am 20. Dezember 1812, erschien der erste Band der Kinder und Hausmärchen. Der zweite Band der Erstausgabe wurde 1815 veröffentlicht, eine zweite Ausgabe erschien 1819 im gleichen Verlag, der 1817 in „Reimersche Buchhandlung“ umbenannt worden war. Diese zweibändige Ausgabe wurde 1822 um einen weiteren Band ergänzt, der die Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen enthielt.
Zur Popularität der Märchensammlung trug maßgeblich die 1825 publizierte sogenannte Kleine Ausgabe mit sieben Kupfern von Ludwig Emil Grimm bei, für die 50 Märchen ausgewählt wurden, die noch heute zu den bekanntesten gehören. Wegen anhaltender Auseinandersetzungen um ausstehende Honorarzahlungen mit Georg Andreas Reimer wechselten Jacob und Wilhelm Grimm den Verlag. Die dritte Auflage der Großen Ausgabe erschien 1837 bei Dieterich in Göttingen. Zu Lebzeiten der Brüder Grimm wurden dort noch vier weitere Auflagen der Großen Ausgabe publiziert: Die vierte Auflage erschien 1840, die fünfte 1843, die sechste 1850 und die siebente, die „Ausgabe letzter Hand“, wurde 1857 veröffentlicht. Die Kleine Ausgabe erschien bis zur fünften Auflage weiterhin bei Reimer, die sechste und siebente Auflage wurden von dem Berliner Verleger Wilhelm Besser veröffentlicht, die achte bis elfte Auflage druckte dessen Geschäftsnachfolger Franz Duncker.
Exponate
Große Ausgabe
Kinder- und Haus-Märchen / gesammelt durch die Brüder Grimm. – Große Ausgabe.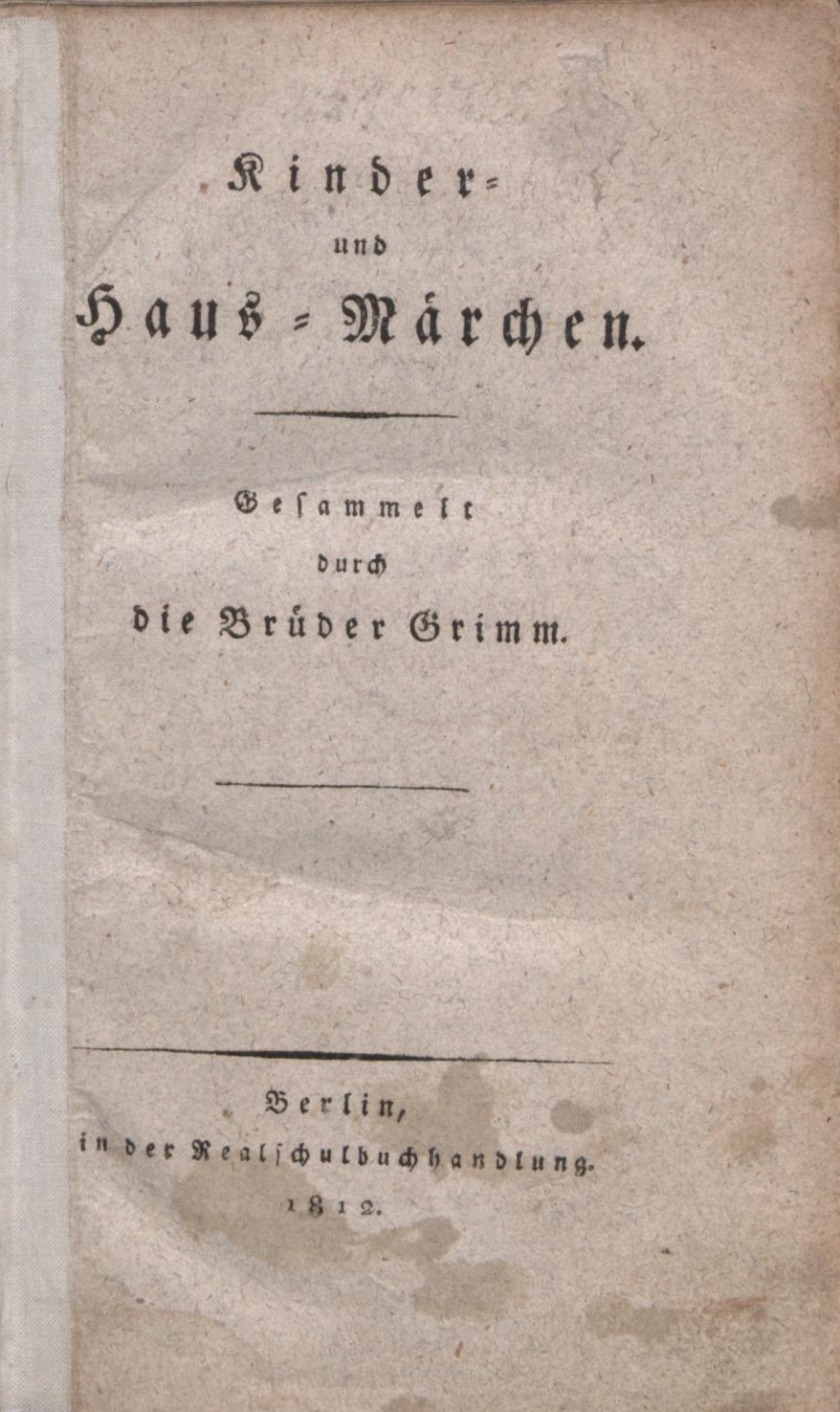
Berlin: Realschulbuchhandlung.
Bd. 1. 1812. – XXVIII, 388, LXX S., 2 Bl.
Bd. 2. 1815. – XVI, 298, LI S.
In einem Band gebunden.
Staatsbibliothek zu Berlin – Abteilung Historische Drucke
Signatur: Yt 1067
Die Erstauflage des ersten Bandes der Kinder- und Hausmärchen wurde am 20.12.1812 in Berlin veröffentlicht. Der Band enthält 86 Märchen. Im Vorwort heißt es: „Wir haben uns bemüht, diese Märchen so rein als möglich war aufzufassen, […] Kein Umstand ist hinzugedichtet oder verschönert und abgeändert worden, denn wir hätten uns gescheut, in sich selbst so reiche Sagen mit ihrer eigenen Analogie oder Reminiscenz zu vergrößern, sie sind unerfindlich.“
(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)
Kinder- und Haus-Märchen / gesammelt durch die Brüder Grimm. – Große Ausgabe.
Berlin: Realschulbuchhandlung.
Bd. 2. 1815. – XVI, 298, LI S.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: B IV 1b, 790-2 R
Der zweite Band wurde erst drei Jahre später publiziert. Im Vorwort wird auch auf die sogenannte „Märchenfrau“ Dorothea Viehmann (1755–1850) hingewiesen, die eine der wichtigsten Beiträgerinnen der Märchensammlung war: „Sie bewahrt diese alten Sagen fest in dem Gedächtniß, welche Gabe, wie sie sagt, nicht jedem verliehen sey und mancher gar nichts behalten könne; dabei erzählt sie bedächtig, sicher und ungemein lebendig mit eigenem Wohlgefallen daran, erst ganz frei, dann, wenn man will, noch einmal langsam, so daß man ihr mir einiger Uebung nachschreiben kann.“
(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)
Kinder- und Haus-Märchen / gesammelt durch die Brüder Grimm. – Große Ausgabe, 2., vermehrte und verbesserte Aufl.
Berlin: Reimer.
Bd. 1. 1819. – LVI, 439 S. : Illustrationen.
Bd. 2. 1819. – LXXI, 304 S. : Illustrationen.
Leihgabe der Freien Universität Berlin
Signatur: 48/74/18887(3)-1 ; 48/74/18887(3)-2
Die Titelillustrationen zum ersten und zweiten Band der zweiten Auflage schuf der Maler und Kupferstecher Ludwig Emil Grimm (1790–1763), der jüngere Bruder von Jacob und Wilhelm. Sie zeigen das Porträt von Dorothea Viehmann (allerdings noch ohne die Unterschrift „Märchenfrau“) und eine Abbildung zu Brüderchen und Schwesterchen.
(Link zu den digitalisierten Exemplaren der Bayerischen Staatsbibliothek: Digitalisierte Sammlungen der BSB)
Kinder- und Haus-Märchen / gesammelt durch die Brüder Grimm. – Große Ausgabe, 2., vermehrte und verbesserte Aufl.
Berlin: Reimer.Bd. 3. 1822. – VI, 441 S.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: B IV 1b, 679-3<2> R
Der dritte Band der Großen Ausgabe erschien erstmals 1822. Er enthält Anmerkungen zu den einzelnen Märchen und gibt Auskunft über die mündlichen und schriftlichen Quellen der Texte.
(Link zum digitalisierten Exemplar der Bayerischen Staatsbibliothek: Digitalisierte Sammlungen der BSB)
Kinder- und Hausmärchen / gesammelt durch die Brüder Grimm. – Große Ausgabe, 3., vermehrte und verbesserte Aufl.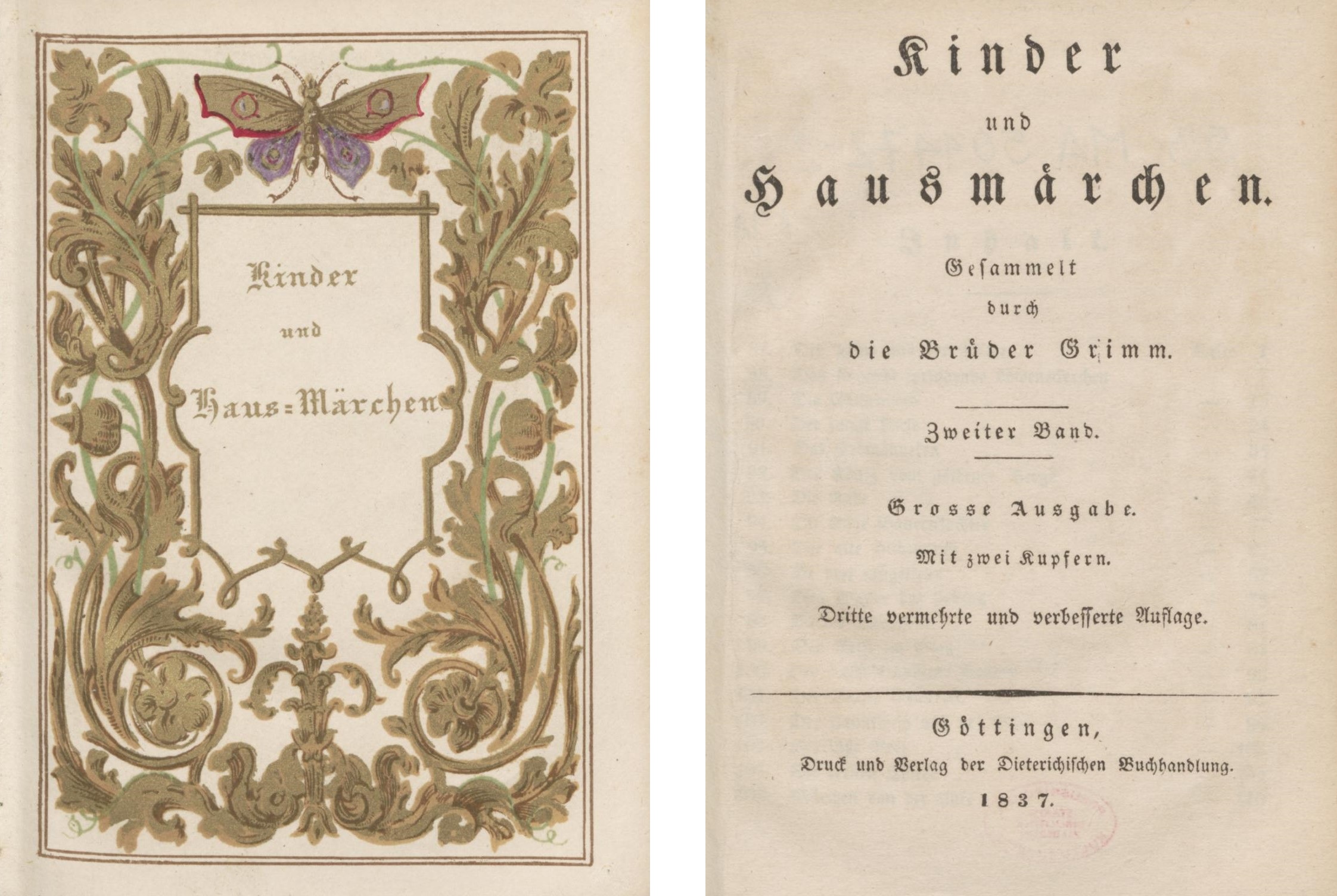
Illustrationen: Ludwig Emil Grimm.
Göttingen: Dieterich.
Bd. 1. 1837. – XXVIII, 513 S. : Illustrationen.
Bd. 2. 1837. – VI, 385 S. : Illustrationen.
Bd. 3. 1856. – IV, 418 S.
Mit 1 Stahlstich als Frontispiz.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: 53 MA 504472 R
Mit der dritten Auflage fand ein bedeutsamer Verlegerwechsel statt, die Große Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen wurde von nun an bei Dieterich in Göttingen publiziert. Die Auseinandersetzungen um fehlende Honorare und die schleppenden Verhandlungen um Neuauflagen hatten Jacob und Wilhelm Grimm zu diesem Schritt veranlasst. (Die Kleine Ausgabe erschien weiterhin bei Reimer.) 1856, fast zwanzig Jahre nach den beiden ersten Teilen, wurde auch der dritte Band mit den Kommentaren zu den Märchen in einer überarbeiteten Fassung erneut veröffentlicht.
(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)
Kinder- und Hausmärchen / gesammelt durch die Brüder Grimm. – Große Ausgabe, 4., vermehrte und verbesserte Aufl.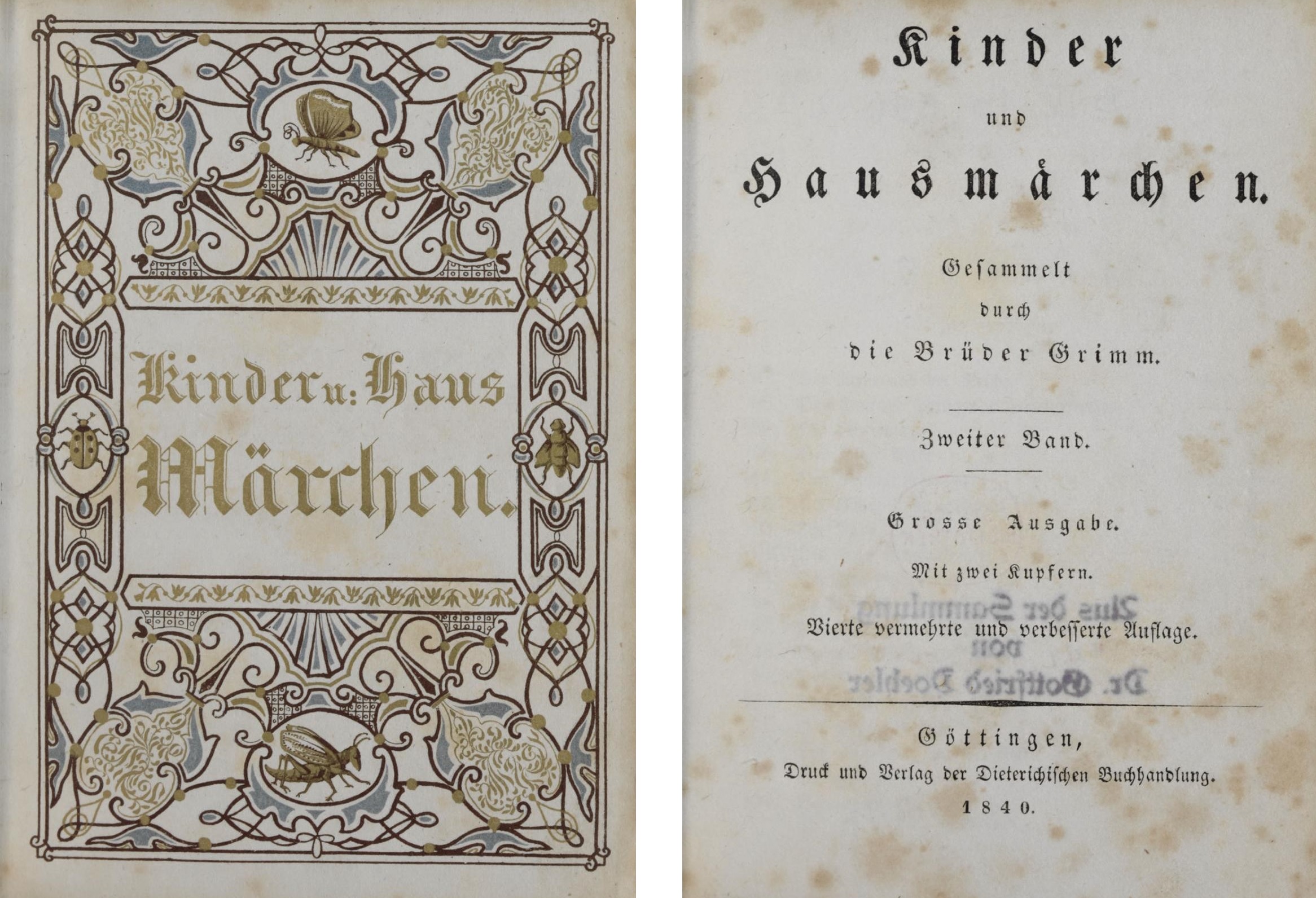
Illustrationen: Ludwig Emil Grimm.
Göttingen: Dieterich.
Bd. 1. 1840. – XXXII, 513 S. : Illustrationen.
Bd. 2. 1840. – VI, 417 S. : Illustrationen.
Mit zwei Kupfern, 1 koloriertem Vortitel, 1 Stahlstich als Frontispiz, eine Vignette im Text.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: B IV 1b, 596<4> R
Anfang der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts erreichte die Popularität der Kinder- und Hausmärchen ihren ersten Höhepunkt. Die Auflagen der Großen Ausgabe wurden nun in kürzeren zeitlichen Abständen geduckt. Die vierte Auflage war drei Jahre später vergriffen und wurde durch eine fünfte stark vermehrte Auflage ersetzt.
(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)
Kinder- und Hausmärchen / gesammelt durch die Brüder Grimm. – Große Ausgabe, 5., stark vermehrte und verbesserte Aufl.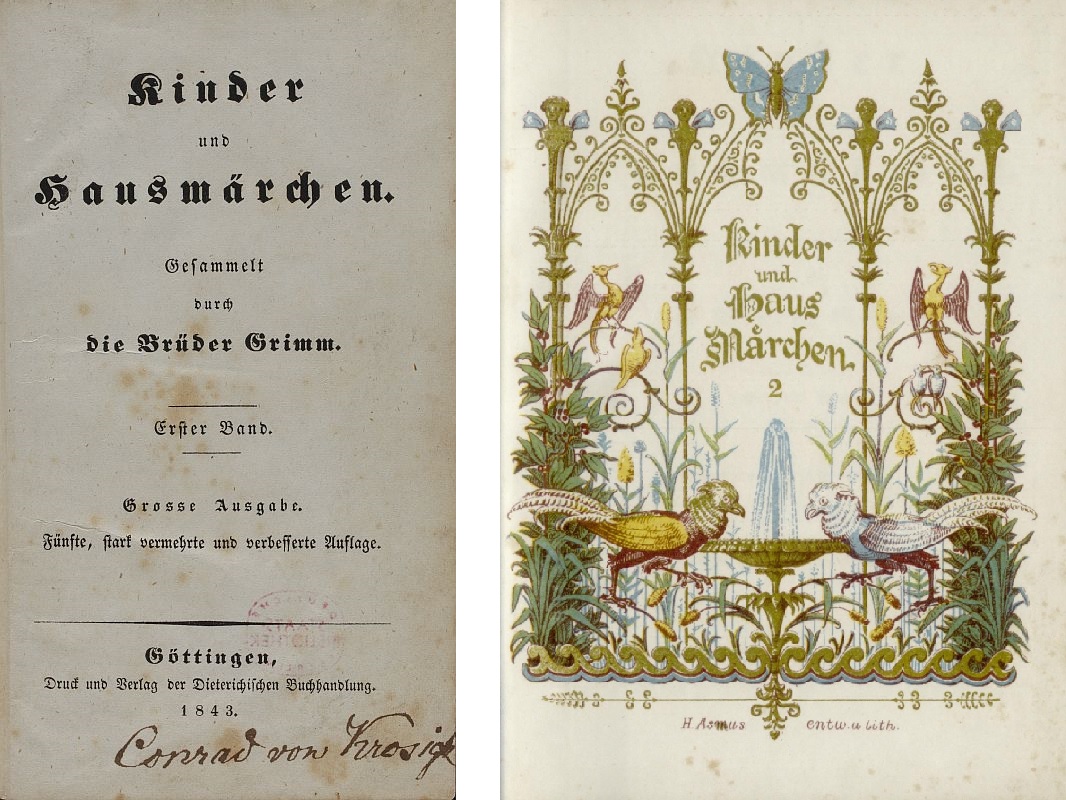
Göttingen: Dieterich.
Bd. 1. 1843. – XXXIV, 504 S.
Bd. 2. 1843. – VI, 523 S.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: B IV 1b, 665 R
Die fünfte Auflage erschien bereits während der Berliner Lebensjahre der Brüder Grimm. Die Widmung an Bettina von Arnim – nach den Widmungen in der ersten und der dritten Auflage bereits die dritte Würdigung der engen Vertrauten von Jacob und Wilhelm Grimm – nimmt auf den neuen Wohnort Bezug: „Diesmal kann ich Ihnen, liebe Bettine, das Buch, das sonst aus der Ferne kam, selbst in die Hand geben. Sie haben uns ein Haus außerhalb der Mauern ausgesucht, wo am Rande des Waldes eine neue Stadt heranwächst, von den Bäumen geschützt, von grünendem Rasen, Rosenhügeln und Blumengewinden umgeben, von dem rasselnden Lärm noch nicht erreicht.“
(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)
Kinder- und Hausmärchen / gesammelt durch die Brüder Grimm. – Große Ausgabe, 6., vermehrte und verbesserte Aufl.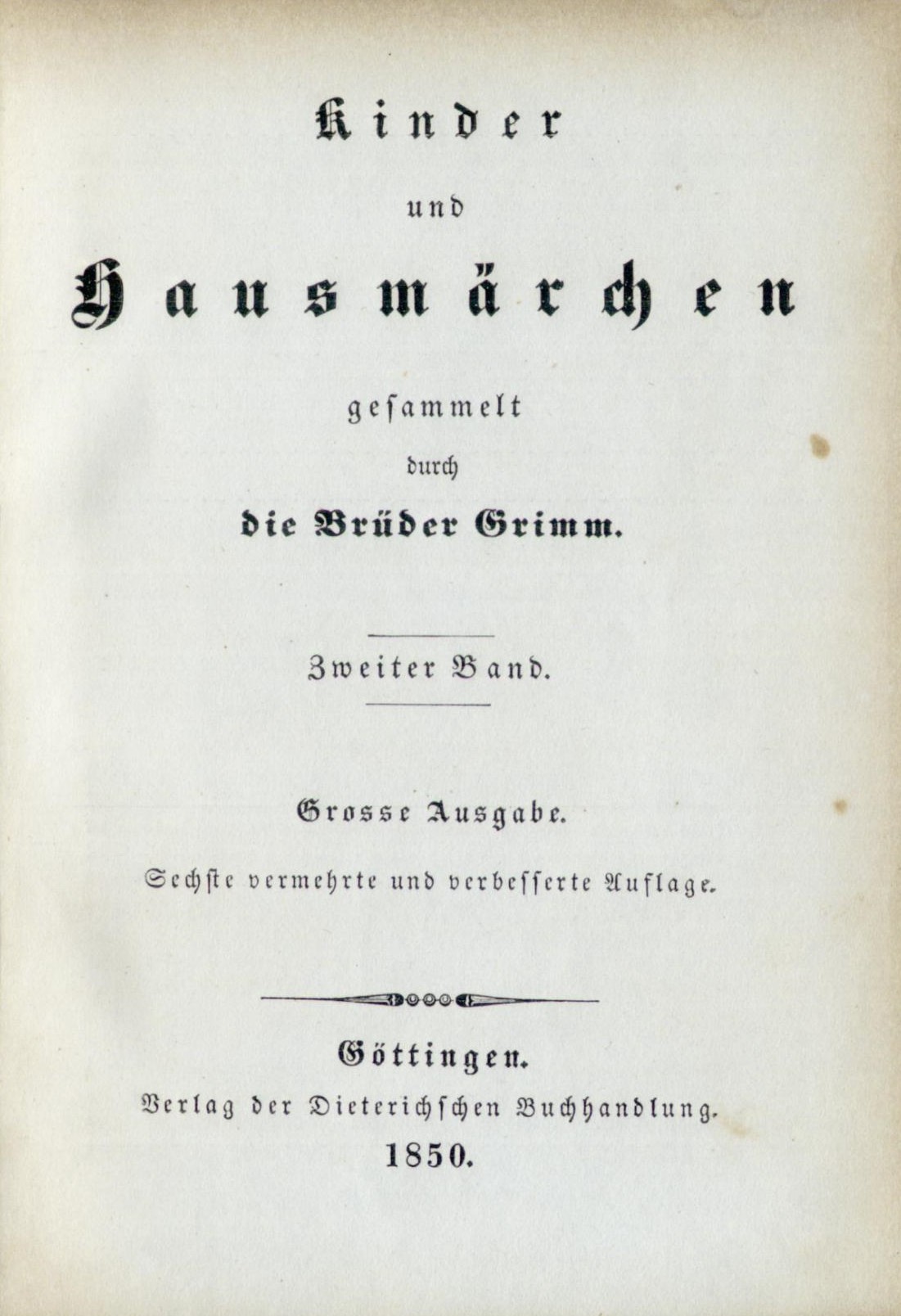
Illustrationen: Ludwig Emil Grimm.
Göttingen: Dieterich.
Bd. 1. 1850. – LXXVI, 501 S.
Bd. 2. 1850. – VI, 562 S. : Illustrationen.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: B IV 1b, 973 R
(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)
Kinder- und Hausmärchen / gesammelt durch die Brüder Grimm. – Große Ausgabe, 7. Aufl.
Illustrationen: Ludwig Emil Grimm.
Göttingen: Dieterich.
Bd. 1. 1857. – XXIV, 431 S. : Illustrationen.
Bd. 2. 1857. – : VI, 483 S. : Illustrationen.
Mit 1 Stahlstich als Frontispiz von Ludwig Emil Grimm.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: B IV 1b, 596<7> R
Die siebente Auflage, die „Ausgabe letzter Hand“, ist die letzte zu Lebzeiten der Brüder Grimm erschienene Edition. Die Sammlung enthält 200 Märchen, beginnend mit Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich, und sieben Kinderlegenden.
(Link zu den von Google digitalisierten Exemplaren der Universitäten Oxford (Bd. 1) und Harvard (Bd. 2): Deutsches Textarchiv)
Kleine Ausgabe
Kinder- und Hausmärchen / gesammelt durch die Brüder Grimm. Mit 7 Kupfern. – Kleine Ausgabe.
Illustrationen: Ludwig Emil Grimm,.
Berlin : Reimer, 1825. – IV, 316 S. : Illustrationen.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: B IV 1b, 752 R
In Deutschland wurden die Kinder- und Hausmärchen vor allem mit der „Kleinen Ausgabe“ berühmt, einer Auswahl von 50 Märchen, zu denen so bekannte Texte wie Dornröschen, Hänsel und Gretel oder Rotkäppchen gehören. Die 1825 veröffentlichte Ausgabe enthält sieben Kupfertafeln von Ludwig Emil Grimm im Stil der Romantik. (Das vorliegende Exemplar hat nur sechs Kupfer.)
(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin
Kinder- und Hausmärchen / Jacob und Wilhelm Grimm. – Kleine Ausgabe. 2., verbesserte Aufl.
Berlin: Reimer 1833. – IV, 316 S.
Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung
Signatur: Nachl. Grimm 146
(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)
Kinder- und Hausmärchen / gesammelt durch die Brüder Grimm.
Illustrationen von H. Leedel nach Ludwig Emil Grimm.
– Kleine Ausgabe, 7. Aufl.
Berlin [u.a.]: Besser, 1847. – IV, 315 S. : Illustrationen.
Mit 1 Stahlstich als Frontispiz.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: B IV 1b, 956 R
Bis zur fünften Auflage erschien die Kleine Ausgabe weiterhin bei Reimer, die sechste und siebente Auflage wurden von dem Berliner Verleger Wilhelm Besser (1809–1848) veröffentlicht.
(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)
Kleine Auswahl früher Übersetzungen der Kinder- und Hausmärchen
Sprookjes-Boek voor Kinderen / Jacob und Wilhelm Grimm.
Amsterdam, 1820.
Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung
Signatur: Nachl. Grimm 149
Diese niederländische Ausgabe ist die erste selbstständig erschienene Übersetzung von Grimmschen Märchen.
(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)
German popular stories / Jacob Grimm und Wilhelm Grimm.
Illustrationen: George Cruikshank
London: C. Baldwyn.Teil 1. 1823. – XII, 240 S. : Illustrationen.
Mit 1 gestaltetem Titelblatt und 11 Tafeln im Text.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: 53 MA 503206-1 R
1823 erschien in London mit der ersten englischen Übersetzung zugleich auch die früheste illustrierte Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen. Der erste Band enthält 12 Radierungen des bekannten englischen Karikaturisten und Illustrators George Cruikshank (1792–1878). Die Brüder Grimm wurden durch diese Edition darin bestärkt, ebenfalls eine illustrierte Auswahl zu publizieren.
Contes de la famille / par les frères Grimm, traduits de l’Allemand par N. Martin & Pitre-Chevalier.
Paris: Renouard, 1846. – 3 Bl., XV, 307 S. : Frontispiz.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: 53 MA 506454 R
Porträts
Jacob und Wilhelm Grimm / Lazarus Gottlieb Sichling.
Berlin, vor 1854.
Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung
Signatur: Nachl. Grimm 693,2
Stahlstich nach einer Daguerreotypie von Hermann Biow
(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)
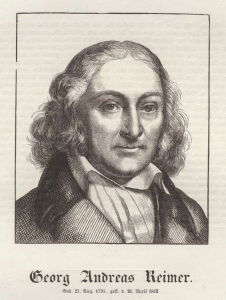
Georg Andreas Reimer : geb. 27. Aug. 1776, gest. d. 26. Apr. 1842
[s. l.], nach 1842
Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung
Signatur: Portr. Slg / Buchhdl. m / Reimer, Georg Andreas, Nr. 2
(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)
Jacob Grimm.
Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung
Signatur: Nachl. Grimm 692,4
Stich von Lazarus Gottlieb Sichling nach einem Gemälde von Carl Joseph Begas.
(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)
Wilhelm Grimm.
Berlin: Kuhr, 1843.
Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung
Signatur: Nachl. Grimm 141, 59
Lithographie nach Karl Burggraf.
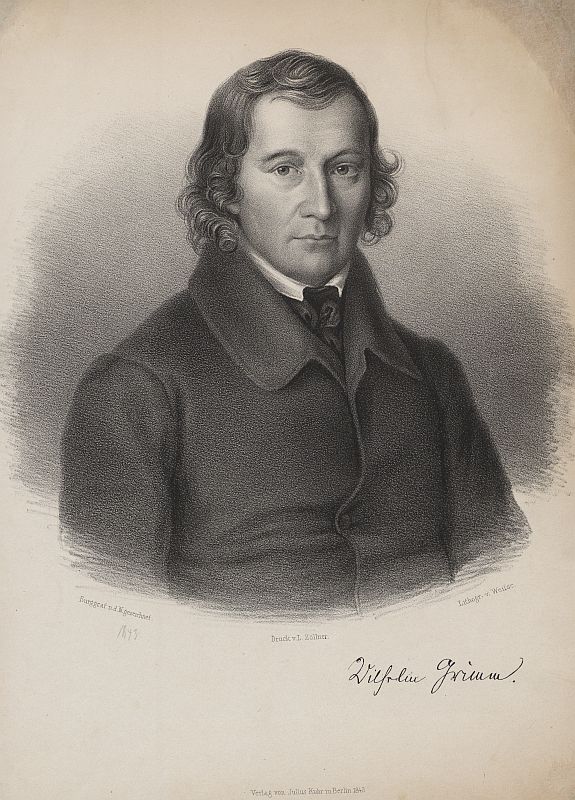
Jacob Grimm / Photo von Philipp Graff Berlin.
Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung
Signatur: Portr. Slg / Philol. Grz./ Grimm, Jacob, Nr. 19
Handschriftliche Dokumente
Georg Andreas Reimer: Brief an Wilhelm Grimm.
Anklam, 17.9.1812.
Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung
Signatur: Nachl. Grimm 1514, Bl. 2r
Transkription (Auszüge):
Georg Andreas Reimer, Verleger der Märchen, an Wilhelm Grimm
Anklam den 17n Septbr. 1812.
[…]
Es freut mich daß Sie meinen durch Arnim Ihnen gemachten Vorschlag annehmlich gefunden haben. In Absicht einer nähern Bestimmung kommt es auf Sie allein an, ob wir die Anzahl der Expl. genau bestimmen wollen, nach deren Absatz das Honorar bezahlt werden soll, oder ob Sie die Summe und Zeit der Zahlung mir anvertrauen wollen; ich werde Ihren Vortheil und meine Verbindlichkeit im letzten Fall nie aus den Augen verlieren. Bei dem allgemein gefühlten Bedürfniß, das Ihr Buch zu befriedigen trachtet, und das Sie gewiß im besten Sinn und mit der wahren Rücksicht auf kindliche Gemüther erfüllen werden, freue ich mich ausnehmend auf das Buch. Was das Aeußere desselben anlangt, so werde ich darin Ihren Wünschen zu begegnen suchen.
Können Sie mir die Handschrift bald zusenden, so will ich den Druck zu befördern suchen, so daß sie im nächsten Monat gedruckt, und daher vor Weihnachten fertig allenhalben zu erhalten seyn kann. Daß es aber unter den obenangeführten Umständen im Meßkatalog fehlt werden Sie entschuldigen. Da das ganze Unternehmen nicht eben ein großes Risiko mit sich führt, so bin ich bereit den zweiten Band erscheinen zu lassen auch ehe der Erfolg über den ersten bestimmt entschieden hat, wenn Sie früher oder später bald damit fertig seyn möchten.
[…]
Leben Sie recht wohl! Meine Familie erfreut sich sehr Ihrer wohlwollenden Erinnerung; lasse Sie diese ferner Ihrem gütigen Andenken empfohlen bleiben
G. Reimer
(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)
Wilhelm Grimm: Brief an Georg Andreas Reimer.
Kassel, 5.1.1813.
Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung
Signatur: Nachl. Grimm 1514, Bl. 35r
Fehlstelle im Blatt durch Siegelausriss.
Transkription (Auszüge):
Wilhelm Grimm an Georg Andreas Reimer, Verleger der MärchenCaßel am 5t Januar 1813.
Lieber Reimer, ich habe Ihre Sendung mit unsern Exemplaren der Märchen richtig erhalten und wiederhole Ihnen meinen Dank für alle Bemühung im Ganzen wie im Einzelnen. Ich habe die Sorgfalt der Correctur erkannt, bis auf die letzten Bogen, wo einige Druckfehler sind, indeßen da sie meist nur ausländische Wörter treffen, wären sie noch zu übersehen gewesen, wenn nicht ein anderes Versehen müßte verbeßert werden. Nämlich No 86 das Vexirmärchen von dem Fuchs ist ganz vergeßen und vexirt demnach mehr als es sollte, es könnte auch wohl auf den zweiten Band warten, allein es ist in dem Anhang p. LVI. LVII. ausführlich commentirt, daher es doch nothwendig muß nachgeliefert werden. Ich bitte sie daher das Blatt 387 u 388. umdrucken zu laßen auf zwei Blätter, so daß auf 388. das Vexirmärchen vom Fuchs kommt und ein neues Blatt zum Anhang S. LXI. die nachzutragenden Anmerkungen enthält sammt den Druckfehlern und Verbeßerungen. […] Ich hoffe, daß Ihnen dies auf keine Art beschwerlich ist und daß den ietzigen Besitzern diese Blätter leicht können nachgeliefert werden. — Außerdem habe ich noch einen Vorschlag. Ich wollte anfangs gern ein Kupfer zu dem Buch, ein Bruder von mir der in München lebt ist, wie man spricht, ein junger Künstler und den hätte ich darum gebeten, wenn die Zeit nicht zu kurz gewesen wäre. Indeßen schickt er mir vor wenigen Tagen aus seinen Studien zwei Kinderköpfchen, die sich allerliebst dazu paßen, Arnim wird Ihnen das Bild zeigen, es sind, wie ich meine, zwei ausgezeichnet liebliche und doch gründlich gedachte Köpfe, die mit gewöhnl. Bücherbildern nicht zu verwechseln sind und einen eigenen Werth haben. Man müßte sie queer vorsetzen, was zwar in etwas gegen die Sitte an sich aber eher beßer wäre; ich zweifle nicht, daß sie dem Buch viele Kaüfer verschaffen werden. Ich habe ihn nun gebeten, die Platte für das Buch herzugeben, ich hoffe, daß er es thun wird, dann soll er sie direct an Sie absenden, Sie laßen dort (falls Sie, wie ich glaube, nichts dagegen haben) die Abdrücke machen und dann könnte das Bild mit den neu gedruckten Blättern den Besitzern des Buchs nachgeliefert werden, die übrigen Exemplare wären dann besser zu broschiren des Bildes wegen. Die Platte wird freilich nicht so viel Abdrücke geben, als Exemplare da sind, da es blos radirt ist, allein sind die erst verkauft schafft er Rath und radirts noch einmal. —
[…]
am 26t Jan.
Der Brief ist liegen geblieben, weil ich erst Antwort von meinem Bruder des Bildes wegen abwarten wollte, die ist nun angekommen, daß er es nicht abgeben kann, also ist es für diesen Band nichts, indeßen will er mir für den zweiten Band etwas anderes radiren.
[…]
Leben Sie wohl und seyn Sie herzlich gegrüßt. W C Grimm.
(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)
Jacob Grimm: Circularbrief wegen Aufsammlung der Volkspoesie.
Wien, 1815.
Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung
Signatur: Nachl. Grimm 1757,6, Bl. 1r
Mit handschriftlichen Notizen von Jacob Grimm.
Diesen Aufruf veröffentlichte Jacob Grimm während seiner diplomatischen Mission auf dem Wiener Kongreß. Der programmatische Text lässt sich als Gründungsdokument der modernen wissenschaftlichen Erforschung der Volkskunde verstehen. Erstmals wird in diesem Forschungsgebiet ein Massenaufruf an eine breite Öffentlichkeit durch zielgerichtete Briefsendungen verwendet.
(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)
Wilhelm Grimm: Der Gläserne Sarg.
Manuskript, o. D.
Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung
Signatur: Nachl. Grimm o. Nr. C 1,4, Bl. 24r
Das Märchen ist eine Abschrift aus dem 1728 in Freiberg erschienenen Roman Das verwöhnte Mutter-Söhngen, dessen Autor nur unter dem Pseudonym „Sylvano“ bekannt ist. Die bearbeitete Fassung Wilhelm Grimms wurde erst in die dritte Auflage der Kinder- und Hausmärchen von 1837 aufgenommen.
(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)

Ausstellung ‚Rotkäppchen kommt aus Berlin!‘ – Die Berliner Ausgaben der ‚Kinder- und Hausmärchen‘ in den Vitrinen sind umgeben von gerahmten Originalillustrationen an den Wänden. / Foto: S. Putjenter SBB-PK
Von der Mitte des 19. Jahrhunderts an wurden die Kinder- und Hausmärchen zunehmend populärer, sie wurden gewissermaßen als „nationales Kulturerbe“ betrachtet. Das hatte zur Folge, dass einzelne Texte – oft unautorisiert – in Märchenausgaben anderer Herausgeber aufgenommen wurden. Nach dem Erlöschen der Urheberschutzfrist im Jahr 1893 setzte eine wahre Flut von Ausgaben der Kinder- und Hausmärchen ein. Die Berliner Drucke spiegeln die gesamte Bandbreite dieser Veröffentlichungen, von ambitionierten verlegerischen Projekten bis zu preiswert hergestellter Massenware. In der um 1900 bei Fischer & Franke in Berlin publizierten Reihe Jungbrunnen, deren Ziel es war, ein „Schatzbehalter deutscher Kunst und Dichtung“ zu sein, erschienen sieben im Jugendstil ausgestattete Märchenbände. Im Verlag Paul Cassirer wurde von 1918 bis 1926 die Reihe Das Märchenbuch herausgegeben, für die so bedeutende Künstler wie Max Slevogt und Leopold Graf von Kalckreuth Grimm’sche Märchen illustrierten. In den dreißiger Jahren erschienen in Berlin Ausgaben mit Illustrationen von Ruth Koser-Michaëls (Knaur, 1937) und Alfred Zacharias (Wiking, 1939).
Der erste Auswahlband mit Grimm’schen Märchen nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Berlin im Dezember 1945 im Altberliner Verlag Lucie Groszer veröffentlicht. Bereits 1946 begannen (zunächst in den westlichen Besatzungszonen, später auch im Ostteil Deutschlands) heftige Debatten um die angeblich verrohende Wirkung der Kinder- und Hausmärchen, in deren Lektüre sogar eine der Ursachen für die Gräueltaten im Nationalsozialismus gesucht wurde. Diese Diskussion ging unter dem Terminus „Märchenstreit“ in die Literaturgeschichte ein.
Die Folgen der Teilung Berlins und die unterschiedliche Entwicklung in den getrennten politischen Einflusssphären werden auch am Beispiel der Grimm-Ausgaben deutlich. Während sich Ostberlin als „Hauptstadt der DDR“ im Bereich des Kinderbuchs zum wichtigsten Verlagsstandort des Landes entwickelte, wanderten die meisten Westberliner Kinderbuchverlage Ende der vierziger, Anfang der fünfziger Jahre in andere Regionen der Bundesrepublik ab. Deshalb erschienen zwischen 1950 und 1990 Ausgaben der Kinder- und Hausmärchen fast ausschließlich im Ostteil der Stadt. Zu diesen Berliner Publikationen zählen so bekannte und verbreitete Drucke wie die von Lea Grundig illustrierte dreibändige Märchen-Edition (EA ab 1952) und die berühmte, bis heute nachgedruckte Ausgabe mit Illustrationen von Werner Klemke (EA 1962). Nach einem deutlichen Rückgang der Berliner Kinderbuchproduktion in der Nachwendezeit hat sich in den letzten Jahren die Zahl der in Berlin ansässigen Kinder- und Jugendbuchverlage wieder erhöht. Einige dieser Verlage, darunter Jacoby & Stuart, Aufbau und der Gestalten-Verlag, haben auch Einzel- und Teilausgaben Grimm’scher Märchen in ihre Programme aufgenommen. Mit dem von Klaus Ensikat illustrierten Band Grimms Märchen (Tulipan) wurde 2010 eine umfangreichere, anspruchsvoll ausgestattete Märchenausgabe in Berlin verlegt.
Exponate
Illustration im Hintergrund: Gisela Röder
Seit rund 190 Jahren, beginnend mit der ersten englischen Übersetzung German popular stories (London, 1823) mit den skurrilen Illustrationen von George Cruikshank, werden die Märchen von Künstlerinnen und Künstlern verschiedener Länder und Stilepochen interpretiert. Der großen Bedeutung von Illustrationen für die Rezeption der Kinder- und Hausmärchen trägt die Ausstellung mit einem eigenen Abschnitt zur Illustrationsgeschichte der Berliner Ausgaben Rechnung. Gezeigt werden Originalvorlagen aus sieben Jahrzehnten – von 1945 bis zur Gegenwart.
Zu den bedeutendsten deutschen Künstlern des 20. Jahrhunderts, von denen die Kinder- und Hausmärchen illustriert wurden, gehört zweifellos der Dresdner Graphiker und Maler Josef Hegenbarth, der hier mit einer unveröffentlichten Arbeit zu Rapunzel vertreten ist. Illustrationen aus den fünfziger Jahren werden am Beispiel der Blätter von Lea Grundig, Erich Gürtzig und Karl Fischer gezeigt. Die wichtigste Berliner Ausgabe der sechziger Jahre war die 1962 erschienene Märchen-Auswahl in der Ausstattung von Werner Klemke. Die Beliebtheit dieses Bandes misst sich auch daran, dass er seit fünf Jahrzehnten in Nachauflagen ständig auf dem Markt ist: 2012 wurde bei Beltz eine Sonderedition zum 200. Jahrestag der Kinder- und Hausmärchen veröffentlicht. So unterschiedliche künstlerische Handschriften wie die von Harald Metzkes und Bernhard Nast repräsentieren die Illustrationskunst der siebziger Jahre. Nach einem Rückgang der Grimm-Ausgaben in diesem Jahrzehnt gab es in den achtziger Jahren einen Boom an Grimm-Interpretationen, den die Ausstellung durch eine angemessen breite Auswahl dokumentiert, zu der u.a. Arbeiten von Peter Becker, Gerhard Bläser, Albrecht von Bodecker, Karl-Georg Hirsch, Gerhard Lahr, Ruth Mossner, Dieter Müller, Gisela Röder und Rainer Sacher gehören. Eine amüsante, ironisch gebrochene Lesart des Märchens Die Bremer Stadtmusikanten legte Klaus Ensikat mit seiner Interpretation aus dem Jahr 1994 vor. Die Vielfalt der Stile und Formen in der Gegenwart spiegeln Illustrationen von Hans Baltzer, Sibylle Leifer, Sabine Wilharm und Judith Zaugg.
Exponate
Originalillustrationen
Originalillustrationen von Karl-Heinz Appelmann aus: Das Dietmarsische Lügenmärchen.
Berlin: Kinderbuchverlag, 1990.
Aquarellierte Federzeichnung
Leihgabe aus dem Besitz des Künstlers
Karl-Heinz Appelmann
Graphiker und Illustrator
Geboren am 12.08.1939 in Swinemünde,
Studium der Graphik an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.
Lebt in Berlin.
Originalillustration und Druck von Hans Baltzer aus: Hans im Glück.
Berlin: Eulenspiegel Verlag, 2002.
Feder, Tusche
Leihgabe aus dem Besitz des Künstlers
Hans Baltzer
Graphiker und Illustrator
Geboren am 14.01.1972 in Berlin,
Ausbildung zum Schriftsetzer. Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und an der NC State University in Raleigh, USA.
Lebt in Berlin.
Originalillustration von Peter Becker aus: Hänsel und Gretel.
Berlin: Altberliner Verlag, 1988.
Öl
Leihgabe aus dem Besitz des Künstlers
Peter Becker
Maler, Graphiker und Illustrator
Geboren am 30. 06.1937 in Berlin, gestorben am 26.09.2017 in Berlin.
Studium der Gebrauchsgraphik an der Hochschule der Künste Berlin (heute Universität der Künste Berlin).
Lebt in Berlin.
Originalillustrationen von Gerhard Bläser aus: Der süße Brei.
Berlin: Kinderbuchverlag, 1987.
Pinsel, Tusche, Bleistift
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Gerhard Bläser
Graphiker und Illustrator
Geboren am 25.04.1933 in Haldensleben, gestorben am 01.10.2009.
Studium der Gebrauchsgraphik und Illustration an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.
Originalillustrationen von Albrecht von Bodecker aus: Herr Korbes.
Berlin: Kinderbuchverlag, 1987.
Andrucke, beigegeben eine handgeschriebene Karte mit Federzeichnung
Leihgabe aus dem Besitz des Künstlers
Albrecht von Bodecker
Graphiker und Illustrator
Geboren am 27.04.1932 in Dresden,
Ausbildung an der Fachschule für Angewandte Kunst in Wismar (heute Hochschule Wismar – University of Applied Sciences: Technology, Business and Design)
Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin (heute Universität der Künste Berlin).
Lebt in Berlin.
Originalillustration von Felix Bork zu Frau Holle.
Unveröffentlicht.
Bachelorarbeit 2012 an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Kohle, Graphitstift, Latexfarbe
Leihgabe aus dem Besitz des Künstlers
Felix Bork
Graphiker
Geboren am 06.03.1988 in Berlin,
Studium zum Kommunikationsdesigner an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.
Lebt in Berlin.
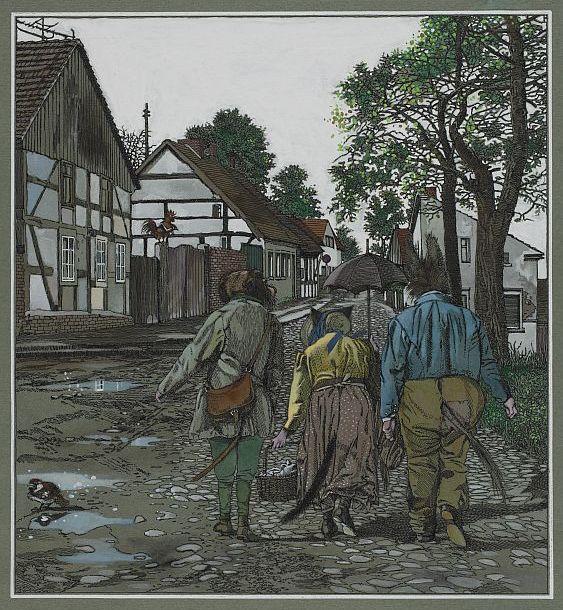 Originalillustrationen von Klaus Ensikat aus: Die Bremer Stadtmusikanten.
Originalillustrationen von Klaus Ensikat aus: Die Bremer Stadtmusikanten.
Berlin: Altberliner Verlag, 1994.
Aquarellierte Federzeichnung
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: 16.29
Klaus Ensikat
Graphiker und Illustrator
Geboren am 16.01.1937 in Berlin,
Ausbildung als Gebrauchswerber. Studium an der Fachschule für Angewandte Kunst in Berlin-Schöneweide.
Lebt in Berlin.
Originalillustrationen von Karl Fischer zu Rumpelstilzchen und Die kluge Else aus: Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm.
Berlin: Kinderbuchverlag, 1956.
Aquarellierte Federzeichnung.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: 18.10.1 ; 18.11.1
Karl Fischer
Graphiker und Illustrator
Geboren am 21.10.1921 in Bismarckhütte (Schlesien), gestorben am 22.09.2018.
Lehre als Gestalter und Dekorateur im Berliner Kaufhaus Union. Besuch der Meisterschule für Graphik und Buchgewerbe in Berlin.
Lebt in Berlin.
Originalillustrationen von Konrad Golz aus: Die goldene Gans.
Berlin: Kinderbuchverlag, 1991.
Aquarellierte Federzeichnung
Leihgabe aus dem Besitz des Künstlers
Konrad Golz
Graphiker und Illustrator
Geboren am 27.02.1936 in Wilkau-Haßlau,
Lehre als Dekorationsmaler. Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.
Lebt in Zühlsdorf bei Berlin.
Originalillustrationen von Lea Grundig zu Der Meisterdieb. Aus: Die Kinder- und Hausmärchen. Band 3.
Berlin: Kinderbuchverlag, 1952.
Feder, Tusche
Leihgabe des Archivs der Akademie der Künste
Lea Grundig
Malerin, Graphikerin und Illustratorin
Geboren am 23.03.1906 in Dresden, gestorben am 10.10.1977 während einer Mittelmeerreise.
Studium an der Akademie der Bildenden Künste Dresden (heute Hochschule für Bildende Künste Dresden).
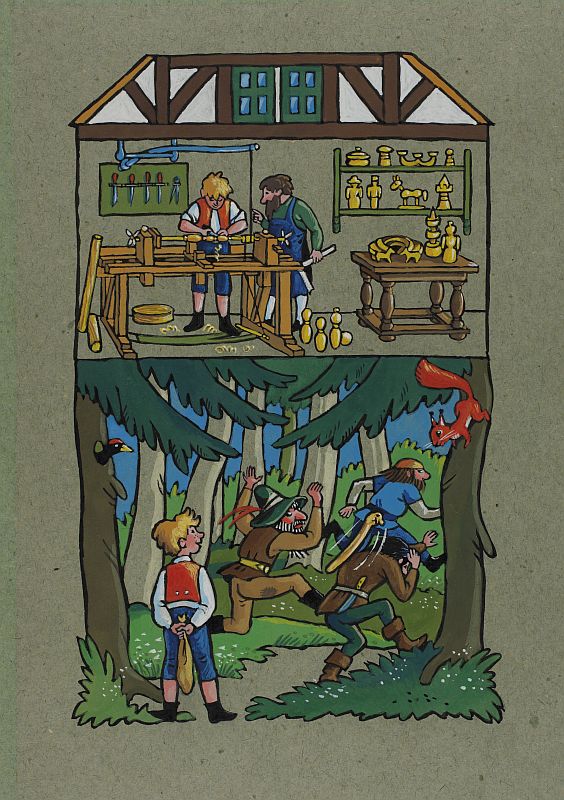 Originalillustrationen von Inge Gürtzig aus: Tischchen deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack.
Originalillustrationen von Inge Gürtzig aus: Tischchen deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack.
Berlin: Kinderbuchverlag, 1983.
Feder, Aquarell, Deckfarben auf farbigem Papier
Leihgabe aus dem Besitz der Künstlerin
Inge Gürtzig
Illustratorin
Geboren am 07.09.1935 in Rostock, verstarb 2020 in Berlin.
Ausbildung an der Fachschule für Angewandte Kunst in Heiligendamm (heute Hochschule Wismar – University of Applied Sciences: Technology, Business and Design und Studium an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee.
Lebt in Berlin.
Originalillustrationen von Erich Gürtzig aus: Der Wolf und die sieben jungen Geißlein.
Berlin: Kinderbuchverlag, 1955.
Aquarellierte Federzeichnung
Leihgabe von Inge Gürtzig
Erich Gürtzig
Graphiker und Illustrator
Geboren am 26.09.1913 in Hamburg, gestorben am 26.06.1993 in Berlin.
Studium der Graphik an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin-Charlottenburg (heute Universität der Künste Berlin).
Originalillustrationen von Josef Hegenbarth zu Rapunzel.
Unveröffentlicht.
Aquarell
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: 33.4 ; 33.6
Josef Hegenbarth
Graphiker, Maler und Illustrator
Geboren am 15.06.1884 in Böhmisch Kamnitz, (Österreich-Ungarn), gestorben am 27.07.1962 in Dresden.
Studium an der Kunstakademie Dresden (heute Hochschule für Bildende Künste Dresden).
Originalillustrationen von Regine Heinecke aus: Das tapfere Schneiderlein.
Berlin: Kinderbuchverlag, 1987.
Bleistift, Buntstift, Aquarell
Leihgabe aus dem Besitz der Künstlerin
Regine Heinecke
Graphikerin, Malerin und Illustratorin
Geboren am 20.08.1936 in Zwickau, gestorben am 07.11.2019 in Bobenneukirchen.
Ausbildung als Lithographin und Offsetretuscheurin. Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig.
Lebt in Bobenneukirchen (Sachsen).
Originalillustration von Karl-Georg Hirsch aus: Der Teufel mit den drei goldenen Haaren.
Berlin: Kinderbuchverlag, 1982.
Tempera.
Leihgabe aus dem Besitz des Künstlers
Karl-Georg Hirsch
Graphiker und Holzstecher
Geboren am 13.05.1938 in Breslau,
Ausbildung zum Stuckateur. Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig.
Lebt in Leipzig.
Originalillustrationen von Günter Hofmann aus: Fundevogel.
Berlin: Buchverlag Der Morgen, 1990.
Ölminiaturen auf Spanschachteln
Leihgabe von Erika Hofmann
Günter Hofmann
Maler, Graphiker und Illustrator
Geboren am 06.02.1944 in Hainichen, gestorben am 26.08.2008 in Hainichen.
Nach Studium an der TU Karl-Marx-Stadt, Lehre zum Chemigraf.
Abendstudium an der Hochschule für Bildende Künste Dresden.
Entwürfe von Erika Klein zu Schneeweißchen und Rosenrot.
Berlin: Kinderbuchverlag, 1967.
Gouache
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Erika Klein
Graphikerin und Illustratorin
Geboren am 04.02.1935 in Berlin, gestorben im Dezember 2003 in Rießen bei Eisenhüttenstadt,
Studium der Graphik an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.
Originalillustrationen von Werner Klemke aus: Die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm.
Berlin: Kinderbuchverlag, 1962.
Schabkarton
Leihgabe des Klingspor-Museums Offenbach
Werner Klemke
Graphiker und Illustrator
Geboren am 12.03.1917 in Weißensee bei Berlin, gestorben am 26.08.1994 in Berlin-Weißensee.
Nach Ausbildung zum Zeichenlehrer an der Lehrerbildungsanstalt in Frankfurt (Oder) Arbeit als Trickfilmzeichner, Professor an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.
Originalillustrationen von Gerhard Lahr aus: Aschenputtel.
Niederwiesa: Nitzsche, 1987.
Aquarell, Gouache, Graphitstift, Deckweiß
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Gerhard Lahr
Maler, Graphiker und Illustrator
Geboren am 11.01.1938 in Reichenberg / Vogtland, gestorben am 23.11.2012 in Berlin.
Lehre als Gebrauchswerber. Studium der Gebrauchsgraphik an der Fachschule für Angewandte Kunst in Magdeburg (heute Kunst- und Handwerkerschule Magdeburg).
Lebt in Berlin.
Holzschnitte von Sibylle Leifer aus: Die Bremer Stadtmusikanten.
Berlin: Wolbern-Verlagsgesellschaft, 2005.
Handabzüge der Künstlerin
Leihgabe aus dem Besitz der Künstlerin
Sibylle Leifer
Malerin, Graphikerin und Fotografin
Geboren am 19.06.1943 in Krakau,
Fotografenlehre. Studium der Malerei an der Hochschule für Bildende Künste Dresden.
Lebt in Dresden und Sanz bei Groß Kiesow (Vorpommern).
Originalillustration von Harald Metzkes aus: Rumpelstilzchen.
Berlin: Kinderbuchverlag, 1970.
Gouache, Deckweiß
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: 45.1.6
Harald Metzkes
Bildhauer, Maler, Graphiker und Illustrator
Geboren am 23.02.1929 in Bautzen,
Lehre zum Steinmetz. Studium der Malerei an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Meisterschüler an der Akademie der Künste in Berlin.
Lebt in Altlandsberg bei Berlin.
Originalillustrationen von Ingeborg Meyer-Rey aus: Die schöne Katrinelje und Pif Paf Poltrie.
Berlin: Kinderbuchverlag, 1987.
Aquarellierte Federzeichnung
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: 22.26.1 ; 22.26.2
Ingeborg Meyer-Rey
Illustratorin
Geboren am 14.12.1920 in Berlin, gestorben am 04.04.2001 in Berlin.
Studium der Illustration und Wandmalerei an der Hochschule für Bildende Künste Berlin (heute Universität der Künste Berlin).
Originalillustrationen von Jutta Mirtschin zu Von dem Tode des Hühnchens.
Unveröffentlicht.
Feder, Aquarell, Deckfarben auf getöntem und strukturiertem Papier
Leihgabe aus dem Besitz der Künstlerin
Jutta Mirtschin
Malerin, Graphikerin und Illustratorin
Geboren am 08.07.1949 in Chemnitz,
Ausbildung zur Akzidenzsetzerin im Druckhaus Leipzig, daneben Besuch der Abendakademie der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Studium der Graphik an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.
Lebt in Berlin.
Originalillustrationen von Ruth Mossner aus: Irische Elfenmärchen.
Berlin: Rütten & Loening, 1985.
Öl
Leihgabe aus dem Besitz der Künstlerin
Ruth Mossner
Graphikerin und Illustratorin
Geboren am 28.02.1947 in Berlin-Charlottenburg,
Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.
Lebt in Berlin.
Originalillustrationen von Dieter Müller aus: Der Wolf ist tot! Der Wolf ist tot!
Berlin: Kinderbuchverlag, 1984.
Kreidestift, Pastellkreide, Feder
Leihgabe von Brigitte Müller
Dieter Müller
Maler und Graphiker
Geboren am 03.06.1938 in Berlin, gestorben am 18.05.2010 in Berlin.
Ausbildung zum Modezeichner. Studium an der Meisterschule für Graphik und Buchgewerbe Berlin-Friedenau und an der Fachschule für Werbung und Gestaltung, Berlin.
Originalillustrationen von Bernhard Nast zu Brüderchen und Schwesterchen. Aus: Märchen.
Berlin: Kinderbuchverlag, 1973.
Gouache, Tusche, Deckweiß
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Bernhard Nast
Graphiker und Illustrator
Geboren am 10.04.1924 in Berlin, gestorben am 03.06.2001 in Berlin.
Besuch der Meisterschule für Graphik und Buchgewerbe in Berlin-Friedenau.
Originalillustrationen von Johannes Niedlich aus: Der goldene Schlüssel.
Berlin: Kinderbuchverlag, 1987.
Aquarellierte Tuschezeichnung mit Rapidograph
Leihgabe aus dem Besitz des Künstlers
Johannes Niedlich
Graphiker und Illustrator
Geboren am 04.03.1949 in Lunow an der Oder, gestorben am 24.04.2014 in Altlandsberg.
Ausbildung zum Bindemittelfacharbeiter. Studium der Chemie und der Theologie.
Lebt in Altlandsberg bei Berlin.
Originalillustrationen von Gerhard Rappus aus: Der Froschkönig.
Berlin: Kinderbuchverlag, 1987.
Federaquarell
Leihgabe von Elke Rappus-Weidemann
Gerhard Rappus
Maler, Graphiker und Illustrator
Geboren am 22.06.1934 in Berlin, gestorben am 29.01.2009 in Berlin.
Ausbildung zum Gebrauchswerber und Gebrauchsgraphiker.
 Originalillustration von Gisela Röder aus: Frau Holle.
Originalillustration von Gisela Röder aus: Frau Holle.
Berlin: Kinderbuchverlag, 1988.
Kaseinfarbe.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: 90.8.8
Gisela Röder
Graphikerin und Illustratorin
Geboren am 05.03.1936 in Schwerin, gestorben am 24.08.2016 in Berlin.
Studium an der Hochschule für Bildende Künste Dresden und an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.
Lebt in Berlin.
Originalillustrationen von Regine Röder aus: Strohhalm, Kohle und Bohne.
Berlin: Kinderbuchverlag, 1990.
Öl auf Karton
Leihgabe aus dem Besitz der Künstlerin
Regine Röder-Ensikat
Autorin, Malerin und Illustratorin
Geboren am 19.04.1942 in Aschersleben, gestorben am 02.01.2019 in Berlin.
Studium der Werbeökonomie an der Fachhochschule für Angewandte Kunst in Berlin mit dem Abschluss Werbedesignerin.
Lebt in Berlin.
Originalillustrationen von Eva Johanna Rubin zu Hänsel und Gretel und Der gestiefelte Kater. Aus: Der gestiefelte Kater und andere Märchen der Brüder Grimm.
Oberursel: Neuer Finken-Verlag, 1990.
Aquarellierte Federzeichnung
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Eva Johanna Rubin
Illustratorin
Geboren am 22.04.1925 in Berlin, gestorben am 26.11.2001 in Berlin.
Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin-Charlottenburg (heute Universität der Künste Berlin).
Originalillustrationen von Rainer Sacher aus: Der süße Brei.
Berlin: Altberliner Verlag, 1984.
Aquarellierte Federzeichnung
Leihgabe aus dem Besitz des Künstlers
Rainer Sacher
Graphiker und Illustrator
Geboren am 27.08.1939 in Berlin, gestorben am 02.08.2019 in Leipzig.
Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.
Lebt in Leipzig.
Originalillustrationen von Brigitte Schleusing aus: Dornröschen.
Berlin: Kinderbuchverlag, 1987.
Aquarell
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signaturen: 135.1.11 ; 135.1.22
Brigitte Schleusing
Autorin und Illustratorin
Geboren am 04.05.1937 in Waren (Müritz),
Studium der Graphik an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.
Lebt in Berlin.
Originalillustrationen von Hannelore Teutsch zu Märchenlegespiel: Erkennen, Vergleichen, Zuordnen. Legespiel für Kinder ab 3 Jahre.
Leipzig: Famos, 1985.
Feder, Aquarell
Leihgabe aus dem Besitz der Künstlerin
Hannelore Teutsch
Malerin, Graphikerin und Illustratorin
Geboren am 04.06.1942 in Berlin,
Ausbildung zur Gebrauchswerberin. Studium der Gebrauchsgrafik an der Fachschule für Angewandte Kunst in Berlin-Schöneweide.
Lebt in Zepernick bei Berlin.
Originalillustration von Sabine Wilharm aus: Vom Fischer und seiner Frau.
Berlin: Aufbau-Verlag, 2010.
Buntstift, Acryl
Leihgabe aus dem Besitz der Künstlerin
Sabine Wilharm
Graphikerin und Illustratorin
Geboren am 04.12.1954 in Hamburg,
Studium an der Fachhochschule für Gestaltung in Hamburg.
Lebt in Quickborn.
Originalillustrationen von Wolfgang Würfel aus: Der alte Sultan.
Berlin: Kinderbuchverlag, 1990.
Aquarell.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: 6.32.1 ; 6.32.2 ; 6.32.3 ; 6.32.4
Wolfgang Würfel
Maler, Graphiker und Illustrator
Geboren am 31.03.1932 in Leipzig, gestorben am 26.01.2025 in Berlin.
Lehrausbildung im Malerhandwerk. Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.
Lebt in Glienicke/Nordbahn bei Berlin.
Druck von Judith Zaugg zu Hänsel und Gretel. Aus: Die illustrierten Märchen der Brüder Grimm.
Berlin: dgv – Die Gestalten Verlag, 2003.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: 140.1.1
Judith Zaugg
Graphikerin und Illustratorin
Geboren am 30.11.1970 in Bern,
Vorkurs & Fachklasse Grafik an der Schule für Gestaltung Bern.
Lebt in Bern.
Originalillustrationen von Franz Zauleck aus: Die Hochzeit der Frau Füchsin.
Berlin: Kinderbuchverlag, 1990.
Aquarellierte Federzeichnung
Leihgabe aus dem Besitz des Künstlers
Franz Zauleck
Bühnenbildner, Autor, Graphiker und Illustrator
Geboren am 03.06.1950 in Berlin,
Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.
Lebt in Berlin und Mecklenburg.
Originalillustrationen von Gertrud Zucker aus: Der alte Großvater und der Enkel.
Berlin: Kinderbuchverlag, 1987.
Schabkarton
Leihgabe aus dem Besitz der Künstlerin
Gertrud Zucker
Graphikerin und Illustratorin
Geboren am 03.01.1936 in Berlin-Weißensee,
Studium der Grafik an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.
Lebt in Bad Saarow.
Die Popularität der Märchen spiegelt sich auch in zahlreichen Bühnenbearbeitungen und Vertonungen nach Vorlagen der Kinder- und Hausmärchen. In Berlin erschienen Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten dramatisierten Fassungen. Der Schauspieler, Regisseur und Bühnenautor Carl August Görner verfasste (neben zahlreichen anderen Theaterstücken) 30 Märchenadaptionen, von denen sieben auf Märchentexten der Brüder Grimm basieren. 1854 fand mit Görners Stück Die drei Haulemännerchen, einer Bearbeitung von Die drei Männlein im Walde, im Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater eine der ersten Aufführungen eines dramatisierten Grimm’schen Märchens in Berlin statt. Besonders nachgefragt waren solche Märcheninszenierungen in der Weihnachtszeit, deshalb legten viele Theater die Premierentermine ihrer Märchenstücke in den Monat Dezember. Damit wurde die Tradition der „Weihnachtsmärchen“ begründet, die vorrangig der Unterhaltung dienten und mehr durch opulente Ausstattung und Bühnentechnik überzeugten als durch literarische Qualität. Die Wegbereiter eines proletarischen Kindertheaters in der Weimarer Republik, zu denen u.a. Edwin Hoernle und Walter Benjamin gehörten, hatten dagegen kaum Interesse an Märchenstoffen. In der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhundert gehörte die Rotkäppchen-Bearbeitung des russischen Schriftstellers Jewgenij Schwarz zu den Erfolgsstücken der Berliner Bühnen. Diese Version wurde sowohl im Berliner Kindertheater in Westberlin als auch im Ostberliner Theater der Freundschaft und an der Volksbühne gespielt. Eine Puppenspielfassung des Stücks wurde an mehreren Puppentheatern aufgeführt.
Vertonungen von Texten der Kinder- und Hausmärchen stammen u.a. von Leo Blech, der eine Oper Aschenbrödel komponierte (UA Prag, 1905), und von Johann Strauss, der den Aschenbrödel-Stoff in einem – allerdings nur fragmentarisch hinterlassenen – Ballett verarbeitete, das 1901 im Königlichen Opernhaus in Berlin uraufgeführt wurde. Das bekannteste musikalische Werk ist Engelbert Humperdincks Oper Hänsel und Gretel (UA Weimar, 1893). Alle drei Berliner Opernhäuser haben diese Oper in ihr Repertoire aufgenommen: Die Berliner Staatsoper zeigte Hänsel und Gretel ab 1963 über mehrere Jahre in einer Inszenierung von Erich-Alexander Winds, an der Deutschen Oper ist das Werk unter der Regie von Andreas Homoki zu sehen und die Komische Oper bereitet mit Reinhard von der Thannen für 2013 eine Inszenierung vor.
Exponate
Musikalien
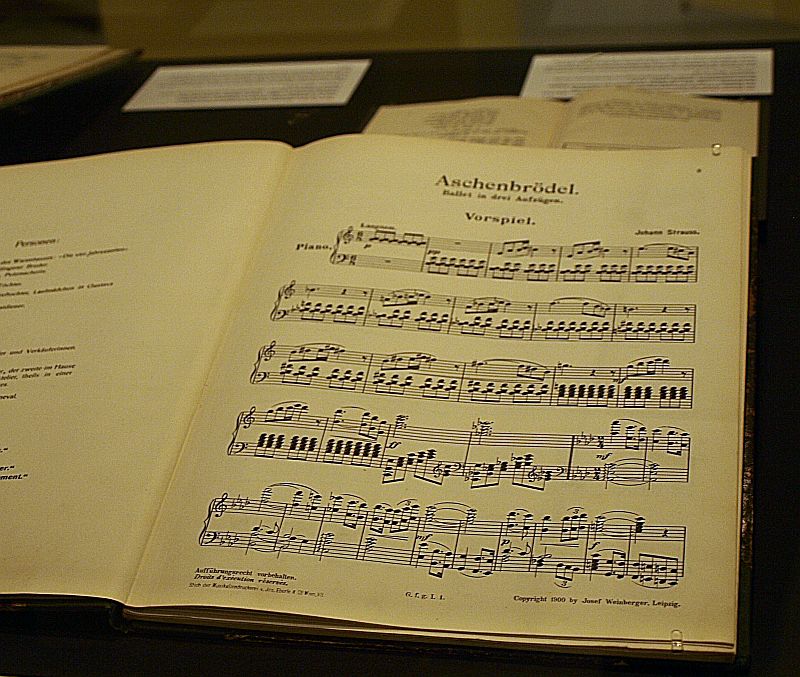 Aschenbrödel: Ballet in drei Aufzügen / von H. Regel. Musik von Johann Strauss.
Aschenbrödel: Ballet in drei Aufzügen / von H. Regel. Musik von Johann Strauss.
Leipzig: Weinberger, 1900. – 99 S. , Clavier-Auszug für zwei Hände.
Staatsbibliothek zu Berlin – Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv
Signatur: DMS 1174
Das aus dem Nachlass stammende Märchen-Ballett wurde am 2. Mai 1901 in Anwesenheit von Kaiser Wilhelm II. im Königlichen Opernhaus zu Berlin uraufgeführt. Aschenbrödel ist das einzige Ballett von Johann Strauss.
Aschenbrödel: ein Märchen in drei Aufzügen / von Richard Batka. Musik von Leo Blech.
Berlin: Bote & Bock, 1905. – 80 S. , Textbuch.
Staatsbibliothek zu Berlin – Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv
Signatur: Mus. Tb 814/20
Eine fast vergessene Märchen-Oper des ab 1906 in Berlin lebenden jüdischen Komponisten und Dirigenten. Leo Blech war bis zu seiner Emigration 1937 Generalmusikdirektor an der Staatsoper Unter den Linden. 1949 kehrte er nach Berlin zurück und verstarb dort 1958.
Dornröschen: Märchen in einem Vorspiel und drei Akten / von E. B. Ebeling-Filhès. Musik von Engelbert Humperdinck.
Leipzig: Brockhaus, 1902. – 120 S., Klavier-Auszug mit Text.
Staatsbibliothek zu Berlin – Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv
Signatur: DMS 25259
Engelbert Humperdinck, der von 1901 bis zu seinem Tod 1921 in Berlin lebte, schrieb diese Märchen-Oper 1902 in der Trabener Straße 2, in Berlin-Grunewald. Das Libretto stammt von der Berliner Jugendbuchautorin Elisabeth Ebeling und ihrer Freundin Bertha Lehmann-Filhés.
Die Bremer Stadtmusikanten: eine lustige Kantate nach dem Märchen der Brüder Grimm für Chor und Solostimmen mit Begleitung von Klavier … ; op. 117 / Dichtung und Musik von Franciscus Nagler.
Berlin-Lichterfelde: Vieweg, 1929. – 11 S.
Staatsbibliothek zu Berlin – Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv
Signatur: Mus. Tn 39
Der Kantor, Schriftsteller und Komponist Franciscus Nagler wurde vor allem durch die Schilderung seiner Kindheitserlebnisse im Erinnerungsband Dorfheimat bekannt. Das volkstümliche Musikstück Die Bremer Stadtmusikanten wurde im Berliner Musikverlag Vieweg herausgebracht.
Hänsel und Gretel-Heft / Engelbert Humperdinck.
Berlin: Ullstein, um 1906. – 60 S.
(Musik für alle: Monatshefte zur Pflege volkstümlicher Musik / Redaktion: Bogumil Zepler)
Staatsbibliothek zu Berlin – Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv
Signatur: N.Mus. 10688-26
Das Hänsel und Gretel-Heft aus dem Ullstein-Verlag Berlin beinhaltet neben einer Bearbeitung von Bogumil Zepler auch zahlreiche Anekdoten rund um die Entstehungsgeschichte der populären Kinderoper. In Berlin wurde Hänsel und Gretel erstmals 1895 im Königlichen Opernhaus zu Berlin aufgeführt.
Programmheft zur Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck / Redaktion und Gestaltung Werner Otto. Illustrationen Prof. Werner Klemke.
Berlin: Deutsche Staatsoper, 1969. – 12. Bl.
Leihgabe aus Privatbesitz
Einliegend ein Besetzungsplan zur 50. Aufführung am 19. Januar 1969.
Bühnendrucke
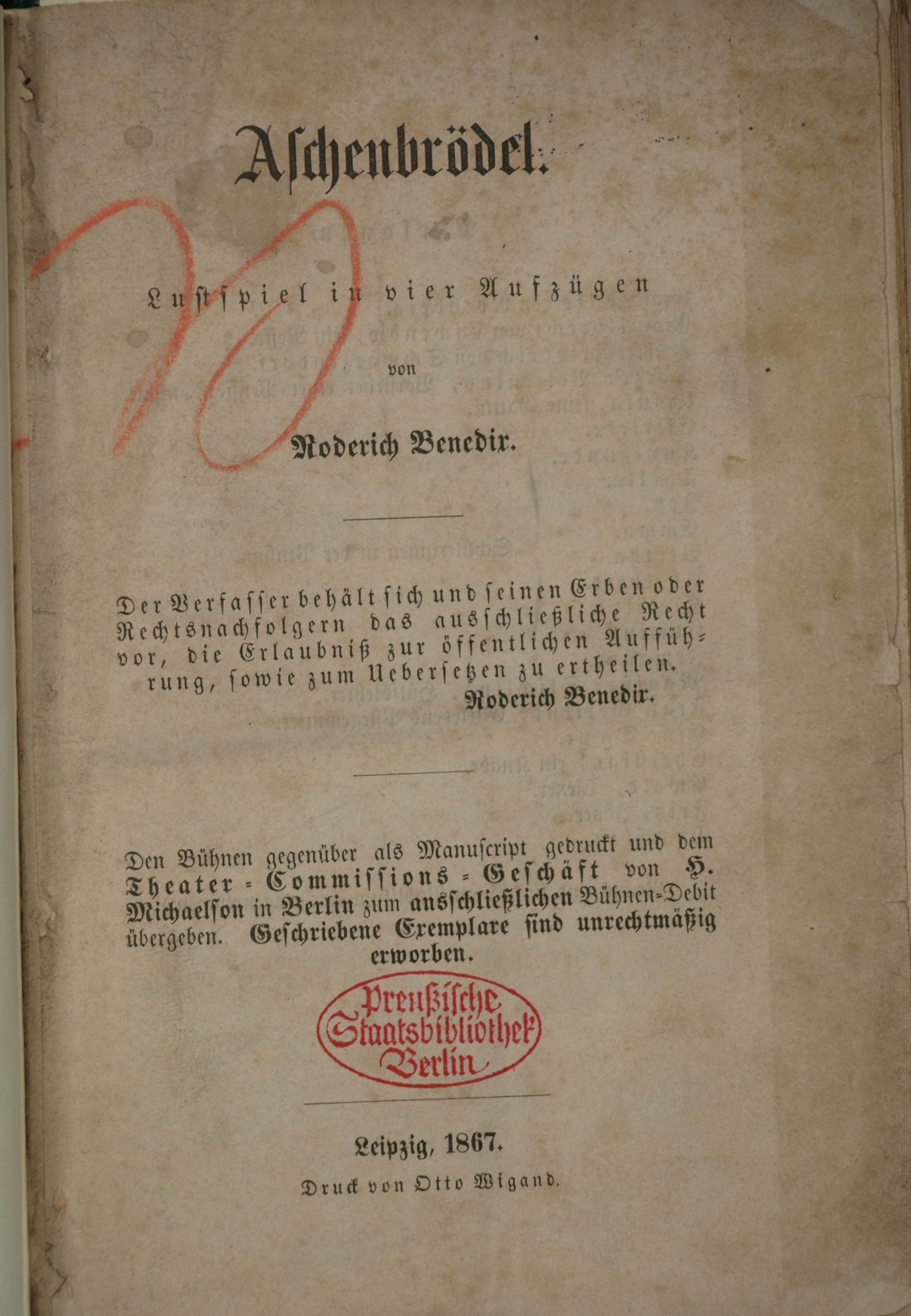 Aschenbrödel: Lustspiel in vier Aufzügen / von Roderich Benedix. Leipzig, 1867. – 98 S.
Aschenbrödel: Lustspiel in vier Aufzügen / von Roderich Benedix. Leipzig, 1867. – 98 S.
Staatsbibliothek zu Berlin
Signatur: Yp 5005-410
Nach der Wiederaufnahme des Stücks 1889 veröffentlichte der Berliner Börsen-Courier folgenden ironischen Kommentar: „Das glückliche Schauspielhaus! Gestern Abend brachte es uns nach mehr als zehnjähriger Pause ‚Aschenbrödel’ von Roderich Benedix. Welche andere große Bühne dürfte ein Gleiches wagen? Da suchen und jagen die Bühnenleiter alle nach den modernen Novitäten; die frischesten, die verwickeltsten Tagesfragen müssen mit Geist und funkelndem Witz auf der Bühne behandelt werden, das gute alte Schauspielhaus nur darf uns mit den verklungenen Ammenmärchen kommen. Was kümmert uns im Schauspielhaus der moderne Realismus, was fragen wir hier nach den Forderungen der Zeit. Hier tragen uns eben die Traditionen des Hauses hinweg vom Lärm des Tages; hier gemahnen uns die Wände schon an vergangene, harmlose Zeiten.“
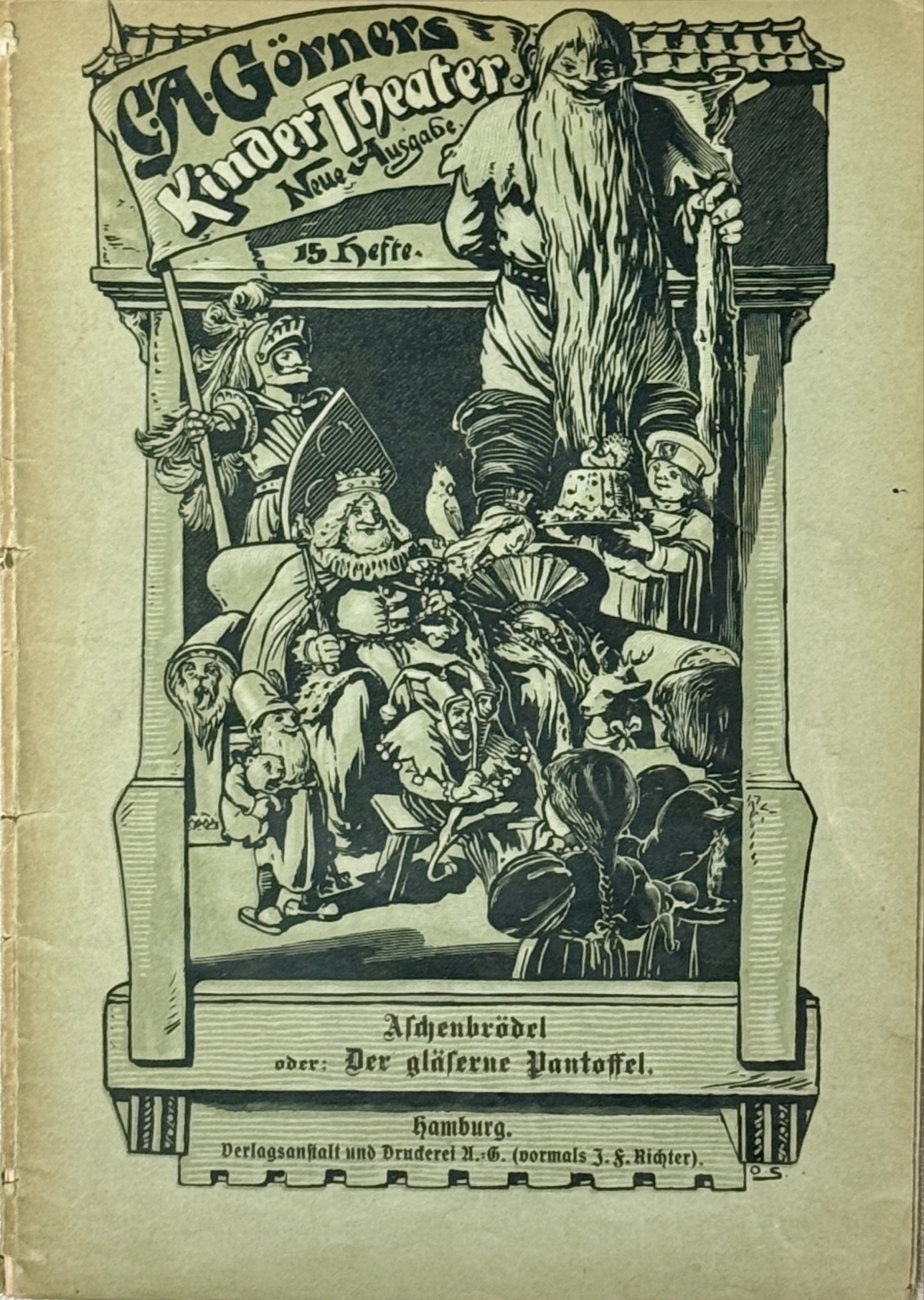 Aschenbrödel oder Der gläserne Pantoffel: eine Kinder-Komödie in 6 Bildern / nach dem gleichnamigen Märchen bearbeitet von C. A. Görner. – 3. Aufl.
Aschenbrödel oder Der gläserne Pantoffel: eine Kinder-Komödie in 6 Bildern / nach dem gleichnamigen Märchen bearbeitet von C. A. Görner. – 3. Aufl.
Hamburg: Verlagsanstalt und Druckerei A.-G., um 1910. – 50 S.
(C. A. Görners Kinder-Theater. Neue Ausgabe ; 12)
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: B XVII 4a, 728
Görners Märchenstück wurde erstmals 1876 im National Theater in Berlin inszeniert. Die didaktische Tendenz des Textes wird in der Rede der Fee Walpugis am Ende des Stücks deutlich:
„So recht, mein Kind!
Bleib immerdar so gut und fromm gesinnt,
Vergelte Böses nie mit Bösem! Lass
Im Herzen Liebe walten, niemals Hass,
Lass nie vom Stolz und Hochmuth Dich beseelen,
Und Gottes Segen wird Dir nimmer fehlen.“
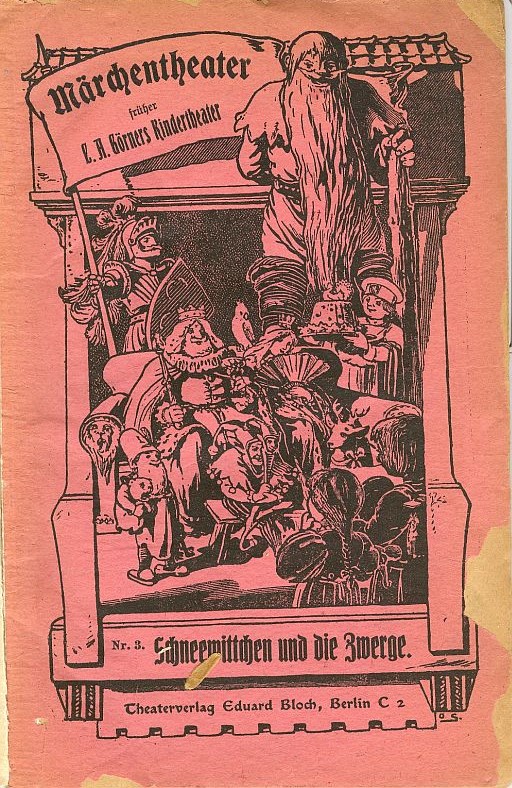 Schneewittchen und die Zwerge: eine Komödie für Kinder in 5 Bildern / nach einem Märchen bearbeitet von C. A. Görner. – 5. Aufl.
Schneewittchen und die Zwerge: eine Komödie für Kinder in 5 Bildern / nach einem Märchen bearbeitet von C. A. Görner. – 5. Aufl.
Berlin: Bloch, 1922. – 40 S.
(Märchentheater ; 3)
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: B II, 354-3
Die Märchenstücke des Schauspielers und Regisseurs Carl August Görner wurden auf den Berliner Bühnen häufig gespielt. Dem Geschmack der Zeit entsprechend verbindet er in seinen Kinderkomödien unterhaltende und moralisch belehrende Elemente. In Berlin wurde Sneewittchen erstmals 1855 als „dramatische Weihnachtskomödie“ inszeniert.
Der Similiberg: nach dem Grimmschen Märchen ; ein Puppenspiel in 1 Vorspiel und 3 Akten / von Hugo L. Mets.
Berlin: Bloch, 1929. – 43 S.
(Eduard Blochs Kasperl-Theater ; 27/28)
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: B II, 353-27/28
Rotkäppchen: Märchenspiel in drei Aufzügen / Jewgenij Schwarz. Deutsch von Alice Wagner. Für den Dramatischen Zirkel mit Regiehinweisen versehen von Herbert Fischer. Musik von Johannes Paul Thilman. Bühnenbilder und Figurinen von Fritz Werner.
Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag, 1953. – 82, 7 S., 6 Bl. : Illustrationen, Notenbeispiele.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: B XVII 4a, 140
Die Rotkäppchen-Adaption des russischen Schauspielers und Bühnenautors Jewgenij Schwarz (1896–1958) entstand in der Zeit des Zweiten Weltkriegs und wurde von den fünfziger Jahren an auf vielen Berliner Bühnen gespielt. Neben der Theaterversion gab es auch eine Bearbeitung für die Puppenbühne.
Rotkäppchen: Puppenspiel in vier Bildern / bearbeitet nach einer Fassung von Jewgenij Schwarz.
Leipzig: Hofmeister, 1957. – 22 S.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: B XVII 4a, 495
Die kluge Susanne: Märchenstücke nach den Gebrüdern Grimm. Heinz Kahlau. Mit einer Nachbemerkung von Christel Hoffmann. Linolschnitte von Sigrid Huß.
Berlin & Weimar: Aufbau-Verlag, 1973. – 142 S.
(Edition Neue Texte)
Staatsbibliothek zu Berlin
Signatur: 318506
König Drosselbart und das Mädchen Prinzessin: nach dem Märchen der Brüder Grimm / Horst Hawemann.
Berlin: Henschelverlag, 1985. – 50 S.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung
Signatur: 7-39 MB 1177
Porträts, Theaterfotos, Kostümentwürfe
Engelbert Humperdinck in seinem Arbeitszimmer.
Berlin: Atlantic-Photo, 1926.
Staatsbibliothek zu Berlin – Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv
Signatur: Mus. P Humperdinck, E. I, 3
Foto.
Engelbert Humperdinck, im Arbeitszimmer seiner Villa in der Waltharistraße in Berlin-Wannsee. Die 1964 abgerissene Villa kaufte er 1912 und ließ sich sogar ein kleines Holzhaus mit Strohdach in den Garten bauen.
(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)
Bertha Lehmann-Filhés
Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung
Signatur: Portr. Slg / Lit. kl / Lehmann-Filhes, Bertha, Nr. 1
Elisabeth Ebeling
Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung
Signatur: Portr. Slg / Lit. kl / Ebeling, Elisabeth, Nr. 1
Leo Blech am Flügel.
Um 1920.
Staatsbibliothek zu Berlin – Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv
Signatur: Mus. P Blech, L. I, 1
Foto.
Leo Blech, ein Schüler von Engelbert Humperdinck, im Alter von ca. 50 Jahren. Er war einer der größten deutschen Dirigenten und erhielt 1913 von Wilhelm II. den Roten Adlerorden und 40 Jahre später das große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland.
Zwei Kostümentwürfe Rotkäppchen und Der Wolf zu Rotkäppchen 54 / Figurinen von George Grosz.
1954.
Inventarnummer: TA 98/14,6 HZ ; TA 98/14,6 HZ
Leihgabe der Stiftung Stadtmuseum Berlin
Die Kostümentwürfe wurden für die Inszenierung von Bilderbogen aus Amerika angefertigt, die im Rahmen der Berliner Festwochen 1954 in der Komödie am Kurfürstendamm gezeigt wurde. Das Stück bestand aus drei sogenannten „Balladen“. Die Entwürfe von George Grosz gehören zu dritten Ballade Rotkäppchen 54, einer amerikanischen Version des Grimm’schen Märchens.
Sechs Szenenfotos von Berliner Theaterinszenierungen nach Vorlagen der Kinder- und Hausmärchen:
Zwei Szenenfotos aus der Inszenierung von Rotkäppchen von Jewgenij Schwarz am Theater der Freundschaft / Fotos Abraham Pisarek und Eva Kemlein .
Berlin, 1951.
Zwei Szenenfotos von Märcheninszenierungen im Titania Palast / Fotos Harry Croner.
Berlin, 1961.
Zwei Szenenfotos aus der Inszenierung von Rotkäppchen von Jewgenij Schwarz am Theater der Freundschaft / Fotos Eva Kemlein.
Berlin, 1963.
Inventarnummer: TA 08/1033 VF ; TA 08/1034 ; VF TA 08/1035 VF ; TA 08/1036 VF ; TA 08/1037 VF ; TA 08/1038 VF
Leihgaben der Stiftung Stadtmuseum Berlin
Vier Szenenfotos von Berliner Theaterinszenierungen nach Vorlagen der Kinder- und Hausmärchen:
Zwei Szenenfotos aus der Inszenierung von Rotkäppchen von Jewgenij Schwarz am Berliner Kindertheater / Fotos Harry Croner.
Berlin, 1972.
Zwei Szenenfotos aus der Inszenierung von Rotkäppchen von Jewgenij Schwarz an der Volksbühne / Fotos Marianne Thiele.
Berlin, 1990.
Inventarnummer: TA 08/1031 VF ; TA 08/1032 VF ; TA 08/1040 VF ; TA 08/1041 VF
Leihgaben der Stiftung Stadtmuseum Berlin
Museale Gegenstände
Papiertheater „Thalia Theater“.
Berlin: Firma Adolf Engel, 1880.
Inventarnummer: TA 97/20SD
Leihgabe der Stiftung Stadtmuseum Berlin
Montierte Bühne mit Figuren zu Rotkäppchen.
Stereoskop.
New York: Underwood & Underwood, um 1910.
Inventarnummer: SM 2012-2068
Leihgabe der Stiftung Stadtmuseum Berlin
Stereoskope sind Bildbetrachter, die bei der Wiedergabe einen Eindruck von räumlicher Tiefe vermitteln. Der hier ausgestellte Apparat wird zum Betrachten der Bilder in der Hand gehalten.
Stereoskopische Fotos, Serie Rotkäppchen im Originalkarton Deutsche Märchen.
Berlin: C. Eckenrath, um 1910.
Inventarnummer: SPG 94/021,01
Leihgabe der Stiftung Stadtmuseum Berlin
Bildwerfer „Pouva Magica“.
Freital: Karl Pouva KG, 1959.
Inventarnummer: SM 2012-2174
Leihgabe der Stiftung Stadtmuseum Berlin
Zwei Rollfilme zu Rotkäppchen und Aschenputtel.
Berlin: DEFA Kopierwerk, 1975.
Inventarnummer: SM 2012-2583 ; SM 2012-2584
Leihgabe der Stiftung Stadtmuseum Berlin
Knusperhexe aus dem Bühnenbild zur Inszenierung der Oper Hänsel und Gretel der Deutschen Staatsoper.
Berlin, 1963.
Leihgabe der Staatsoper im Schillertheater
Kostüm der Hexe aus der Inszenierung der Oper Hänsel und Gretel der Deutschen Oper.
Berlin, 2008.
Leihgabe der Deutschen Oper Berlin
Puppen aus dem Puppenspiel Der gestiefelte Kater / von Jutta Mirtschin.
Berlin, 1981.
Die Berliner Malerin und Illustratorin Jutta Mirtschin übernahm die Ausstattung für das Stück Der gestiefelte Kater im Puppentheater Berlin und fertigte auch die Puppen an.
Jacob und Wilhelm Grimm haben die letzten zwei Jahrzehnte ihres Lebens in Berlin verbracht. Zur Zeit ihrer Ankunft in Berlin waren sie bereits bekannte Gelehrte, deren Ruhm sich während ihrer Berliner Jahre noch weiter verbreitete. Obwohl sie für ihre bedeutenden wissenschaftlichen Forschungen im In- und Ausland gleichermaßen anerkannt sind, ist ihr Name in der breiten Öffentlichkeit vor allem mit den Kinder- und Hausmärchen verbunden.
Die Stadt Berlin ehrt ihre einstigen Bewohner mit drei Straßen, die ihren Namen tragen: der Grimmstraße in Kreuzberg, der Grimmstraße in Lichtenrade und der Brüder Grimm-Gasse in Berlin-Tiergarten. Wesentlich häufiger als die Verfasser wurden jedoch ihre Märchen als Namensgeber von Straßen benutzt, 44 Straßen und Wege wurden nach Figuren aus den Kinder- und Hausmärchen benannt. Im Köpenicker Märchenviertel erhielten sieben Straßen so poetische Namen wie Zu den sieben Raben, Sterntalerstraße oder Däumlingsweg. Außerdem wurden Wege in Berliner Kleingartenanlagen und im Forst Düppel sowie mehrere Straßen in Neukölln nach Märchen der Brüder Grimm benannt.
Das bekannteste Wahrzeichen der Stadt, das an die Märchen der Brüder Grimm erinnert, ist der Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain. Der Entwurf der Anlage stammt von dem Architekten Ludwig Hoffmann, der für den Skulpturenschmuck des Brunnens mit den Bildhauern Ignatius Taschner, Georg Wrba und Josef Rauch zusammenarbeitete. Der Brunnen zeigt Figuren aus neun Märchen der Brüder Grimm: Hänsel und Gretel, Der gestiefelte Kater, Hans im Glück, Die sieben Raben, Aschenputtel, Rotkäppchen, Brüderchen und Schwesterchen, Schneewittchen und Dornröschen. Neben dem Märchenbrunnen in Friedrichshain gibt es in Berlin drei weitere Brunnen mit Skulpturen nach Märchenmotiven: den Neuköllner Märchenbrunnen, den Gänselieselbrunnen in Wilmersdorf und den Froschkönigbrunnen in Pankow.
Eine besondere Würdigung wurde den Brüdern Grimm mit der Namensgebung für den 2009 eröffneten Neubau der Bibliothek der Humboldt-Universität, dem Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum, zuteil.
Exponate
Bücher
Fünf original gezeichnete und geschriebene Miniaturbücher:
Berlin, 1985/1986.
Enthalten sind:
Der Wolf und die sieben Geißlein / illustriert von Hannelore Teutsch.
Rotkäppchen / illustriert von Hannelore Teutsch.
Frau Holle / illustriert von Hannelore Teutsch.
Hänsel und Gretel / illustriert von Hannelore Teutsch.
Das tapfere Schneiderlein / illustriert von Hannelore Teutsch.
Leihgabe aus Privatbesitz
Die Bücher wurden von der Malerin Hannelore Teutsch für ihre Tochter angefertigt.
Karten und Stadtpläne
Plan von Berlin / gezeichnet und lithographiert in der Lithografischen Anstalt von Hermann Delius.
Berlin: Hermann Delius, ca. 1850.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kartenabteilung
Signatur: Kart. X 17773
Lithographie, 70 x 51 cm, ca. 1:5.000.
Mit Bergstrichen und Hervorhebung besonderer Gebäude.
Auf Leinwand aufgezogen. – Aus dem Königlichen Kartographischen Institut Berlin.
(Blattgröße 73 x 54).
Auf dem Plan wurden mit roten Pfeilen die Wohn- sowie die wichtigsten Arbeitsorte der Brüder Grimm markiert. Die Familie wohnte zunächst in der Lennéstraße 8, zog 1846 in die Dorotheenstraße 47 um und lebte ab 1847 in der Linkstraße 7. Die Wohngebäude sind nicht mehr erhalten. Die Hauptarbeitsorte der Grimms waren die Berliner Universität, die Akademie der Wissenschaften und die Königliche Bibliothek.
Berlin / entworfen und lithographiert von Robert Geissler.
Berlin: Geissler, 1868.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kartenabteilung
Signatur: Kart. X 17955
Vogelschau, 87 x 55 cm
(Blattgröße 92 x 62 cm).
Diese Vogelschaukarte wurde zwar erst fünf Jahre nach dem Tod Jakob Grimms gedruckt, vermittelt aber dennoch einen guten Eindruck von der Ausdehnung und dem städtebaulichen Erscheinungsbild Berlins in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also in der Zeit, in der die Brüder Grimm hier lebten.
(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)
Verwaltungsbezirk Cöpenick und Lichtenberg, Blatt IV ca. – 1. Aufl.
Berlin,1930.
Aus: Stadtplan von Berlin, 1:4.000, Berlin: Zentralvermessungsamt
1925–1947.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kartenabteilung
Signatur: Kart X 18383- IV ca
Kolorierter Gisaldruck, 83 x 63 cm. (Blattgr. 95 x 70 cm).
Nach dem Ersten Weltkrieg entstand zwischen dem Köpenicker Bahnhof und dem Wolfsgarten im ehemaligen Forstgebiet Mittelheide das Köpenicker Märchenviertel. Die Straßen B, C, D, E, F und J wurden am 26.07.1927 nach sieben bekannten Figuren aus den Märchen der Brüder Grimm benannt.
Silva-Übersichtsplan von der Stadt Berlin und ihren 20 Verwaltungsbezirken auf Grund des Gesetzes von 1920 / Zustand März 1925. Bearbeitet und herausgegeben von Willy Holz.
Berlin: Flemming und Wiskott, 1925.
Staatsbibliothek zu Berlin – Kartenabteilung
Signatur: Kart. 8959
1:30.000.
Auf dieser Karte aus dem Jahr 1925 wurde in Köpenick jener Bereich markiert, in dem zwei Jahre später die Umbenennungen von Straßen nach Figuren aus den Kinder- und Hausmärchen erfolgen sollten, im sogenannten Köpenicker Märchenviertel.
Museale Gegenstände
Rotkäppchen und der Wolf.
Leihgabe des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg
Gips-Nachbildung der Skulptur am Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain.
Spiel Märchen-Lotto mit Kasten und Spielanleitung.
Berlin, 1959.
Inventarnummer: SM 2012-2578
Leihgabe der Stiftung Stadtmuseum Berlin
Kasten mit Lottokarten zu den Märchen Schneewittchen und die sieben Zwerge, Der Wolf und die sieben Geißlein, Der gestiefelte Kater, Hänsel und Gretel, Dornröschen und Rotkäppchen sowie einer Spielanleitung.
Fotogalerie
Bildbeschreibungen
Foto 1 - 3
1 – Jacob-und-Wilhelm Grimm-Zentrum
in 10117 Berlin (Mitte), für die Humboldt-Universität zu Berlin von Max Dudler geplant und am 12. Oktober 2009 eröffnet. /Foto: C. Schenk SBB-PK
2 – Brüder-Grimm-Haus
Turmstr. 75, 10551 Berlin (Moabit), 1874 – 1876 von Hermann Blankenstein erbaut, 1914/15 von Ludwig Hoffmann erweitert. /Foto: C. Schenk SBB-PK
3 – Tröpfelbrunnen, Wilmersdorf
„Froschkönig“ Tröpfelbrunnen von Stephan Horota, 1987 am Teutoburger Platz in Prenzlauer Berg (10119 Berlin) aufgestellt. /Foto: C. Seifert SBB-PK
Foto 4 - 6
4 – Gänseliesel-Brunnen, Wilmersdorf
Gänseliesel-Brunnen am Nikolsburger Platz in Wilmersdorf (10717 Berlin), 1910 von Cuno von Uechtritz geschaffen, 1988 von Harald Haacke nachgebildet. /Foto: C. Seifert SBB-PK
5 – Märchenbrunnen, Neukölln
Märchenbrunnen im Von-der-Schulenburg-Park in Neukölln (12057 Berlin), Planung 1915-1918, 1934 aufgestellt /Foto: C. Seifert SBB-PK
6 – Märchenbrunnen, Friedrichshain
Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain (10249 Berlin), errichtet 1901-1913 /Foto: C. Seifert SBB-PK
Foto 7 - 9
7 – Brüder-Grimm-Gasse
in 10785 Berlin (Tiergarten), benannt am 3. Dezember 1997/Foto: S. Putjenter SBB-PK
8 – Gebrüder-Grimm-Weg
in der Kleingarten-Anlage „Märchenland“ in 13088 Berlin (Malchow / Weißensee), Benennung im Jahre 1939/Foto: S. Putjenter SBB-PK
9 – Hänselplatz
in 12057 Berlin (Neukölln), benannt am 16. August 1928 /Foto: S. Putjenter SBB-PK
Foto 10 - 12
10 – Sterntalerstraße
in 12555 Berlin (Köpenick), benannt am 26. Juli 1927 /Foto: S. Putjenter SBB-PK
11 – Grimmstraße
benannt am 1. November 1874 /Foto: S. Putjenter SBB-PK
12 – Grabsteine der Brüder Jakob und Wilhelm Grimm
auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof in 10829 Berlin (Schöneberg) /Foto: S. Putjenter SBB-PK
Zum Entstehen dieser virtuellen Ausstellung
Zum 200. Jubiläum dieser Erstausgabe zeigte die Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz im Winter 2012/13 eine opulent bestückte Präsentation im Ausstellungsraum des Hauses an der Potsdamer Straße: „Rotkäppchen kommt aus Berlin!“ Es handelte sich dabei um ein Gemeinschaftsprojekt der Kinder- und Jugendbuchabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin, der Arbeitsstelle Grimm-Briefwechsel am Institut für deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin sowie von MÄRCHENLAND – Deutsches Zentrum für Märchenkultur.
Da absehbar war, dass das Thema von dauerhaftem Interesse sein würde, wurde parallel zur analogen Version bereits im November/Dezember 2012 von der Kinder- und Jugendbuchabteilung im Rahmen der damaligen digitalen Möglichkeiten und innerhalb der Grenzen des Urheberrechts eine Onlineversion – die erste virtuelle Ausstellung der Stabi – ins Netz gestellt. Deren Haltbarkeit war nun zwar deutlich länger als die Dauer der analogen Präsentation, vom 9. November 2012 bis zum 5. Januar 2013; doch auch Digitales kommt in die Jahre.
Daher haben wir in der Kinder- und Jugendbuchabteilung anlässlich des 200. Jubiläums der „Kleinen Ausgabe“ der Kinder- und Hausmärchen die alte Onlineausstellung virtuell aufpoliert.
Ein großer Dank gilt in diesem Zusammenhang unserer Praktikantin, Nina Breloh, sowie unserer IT-Kollegin Marina Fritzsche und ihrem Kollegen Thomas Reimer!