Geeignet für
Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe im Deutsch-Grundkurs oder Leistungskurs
In dieser Unterrichtseinheit analysieren die Schülerinnen und Schüler (SuS) ein zentrales Motiv des Lustspiels Der zerbrochne Krug von Heinrich von Kleist: die Komik. Ausgehend von persönlichen komischen Leseeindrücken nähern sie sich dem Thema in drei verschiedenen Ausdrucksformen an:
(1) der Sprachkomik
(2) der Situationskomik
(3) der Figurenkomik
Zu diesem Zweck werden die SuS zunächst den drei thematischen (Komik-)Gruppen zugeteilt, in welchen die gemeinsame Lektüre und Analyse jeweiliger Textauszüge des Lustspiels erfolgen. Nach zusätzlichen Hinweisen durch die Lehrkraft, einem gemeinsamen „Warm-Up“ und einer weiteren (Lese-)Probephase in den Gruppen werden die drei Auszüge schließlich im Plenum in Form einer „szenischen Lesung“ performativ dargeboten und im Anschluss diskutiert.
Ziel der Lehreinheit ist es, allen SuS die verschiedenen Ausdrucksformen der Komik von Kleists Der zerbrochne Krug zu vermitteln und dabei auch auf ihr Ineinandergreifen hinzuweisen. Die Auseinandersetzung mit dem Thema fördert das allgemeine Text- und Figurenverständnis, da eine Analyse und kreative Inszenierung der drei Komikarten die Handlungsmotive und Charaktereigenschaften einzelner Figuren stärker hervorhebt, als es womöglich ein stilles Lesen in Einzelarbeit zulässt. Gerade die performative Handhabung des Textes und die eigene kreative Umsetzung fördert ein besonderes Nachdenken über Dramenliteratur als „Text für die Bühne“. So wird eine Bearbeitung und Interpretation des literarischen Gegenstands über die eigentliche Textebene hinaus angestrebt. Zusätzlich erhalten die SuS die Möglichkeit über die Gattungsart des „Lustspiels“ bzw. der „Komödie“ als solche/s und den Humor der Zeit nachzudenken.
Dieser Beitrag entstand im Rahmen des Hauptseminars Heinrich von Kleist, Der zerbrochne Krug – Abiturlektüre und Experiment, das Prof. Anne Fleig und Prof. Irene Pieper am Institut für Deutsche und Niederländische Philologie der Freien Universität Berlin gemeinsam mit der Staatsbibliothek zu Berlin im Wintersemester 2024/2025 angeboten haben. Erarbeitet von Hanna Böckmann, Chris Verfuß, Marlene Feger, Ruining Jia, Luise Manz.
Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe im Deutsch-Grundkurs oder Leistungskurs
Sichere Textkenntnis
Heinrich von Kleist: Der zerbrochne Krug. Studienausgabe. Hrsg. v. Bernd Hamacher. Ditzingen: Reclam, 2024.
90 Minuten
Arbeitsblätter, Infokarten (vgl. Download) sowie Stifte
Für die Umsetzung der Lehreinheit können
Skript für die Lehrkraft (Pdf)
Tabellarischer Verlaufsplan für die Lehrkraft (Pdf)
zu Hilfe genommen werden.
Sachanalyse (Pdf)
Didaktische Perspektivierung (Pdf)
Erwartungshorizont der Tabelle (für „Erarbeitung II“) (Pdf)
s.a. weitere Literaturangaben
Virtuelle Ausstellung zu Heinrich von Kleists Leben und Werk
Lehrkraft projiziert das Thema der Stunde an die Tafel (vgl. rechts: Folie 1 der Folien für den Unterricht).
Gemeinsames Brainstorming im Plenum: persönliche Leseeindrücke der SuS erfragen. Vier lustige Zitate aus dem zerbrochnen Krug dienen an der Tafel als Anregung und Diskussionsgrundlage (vgl. rechts Folie 2 der Folien für den Unterricht):
Zitat 1 (Vers 1060-1061)
„In eurem Kopf liegt Wissenschaft und Irrthum / Geknetet, innig, wie ein Teig, zusammen” (V. 1060-61)
Zitat 2 (Vers 1086-1087)
„Ihr greift, ich seh, mit eurem Urtheil ein, / Wie eine Hand in einen Sack voll Erbsen.” (V. 1086-87)
Zitat 3 (Vers 563)
„Und meine Hühner nenn’ ich meine Kinder.” (V. 563)
Zitat 4 (Vers 840)
„Stets liegt der Kloß von Nudeln mir im Sinn” (V. 840)
Folien für den Unterricht (1-9) (Pdf): F1, F2
Aufgabe (mündlich von Lehrkraft kommuniziert):
Lehrkraft teilt SuS in Gruppe A, B und C ein und teilt drei unterschiedliche Arbeitsblätter A, B oder C (vgl. Material rechts) aus:
Arbeitsblatt A: Sprachkomik
Arbeitsblatt B: Situationskomik
Arbeitsblatt C: Figurenkomik
3 Gruppen à ca. 5 SuS
Zur weiteren Beschäftigung zum Thema Komik:
Wirth, Uwe, und Julia Paganini. Komik: Ein Interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart: J.B. Metzler Verlag, 2017. Stabikat
Lehrkraft projiziert den Arbeitsauftrag an die Tafel (vgl. rechts: Folie 3 der Folien für den Unterricht):
SuS finden sich in ihrer Gruppe zusammen. Sie lesen innerhalb der Gruppe die jeweilige Textstelle (auf ihrem Arbeitsblatt) mit verteilten Rollen inkl. Regieanweisungen laut vor und klären ggf. Fragen / Unsicherheiten.
Die Lehrkraft teilt je nach Gruppe drei unterschiedliche Infokarten A, B oder C (vgl. Material rechts) aus. Die SuS lesen die Infokarte A, B oder C zu ihrer Form der Komik durch.
Infokarte A: Sprachkomik
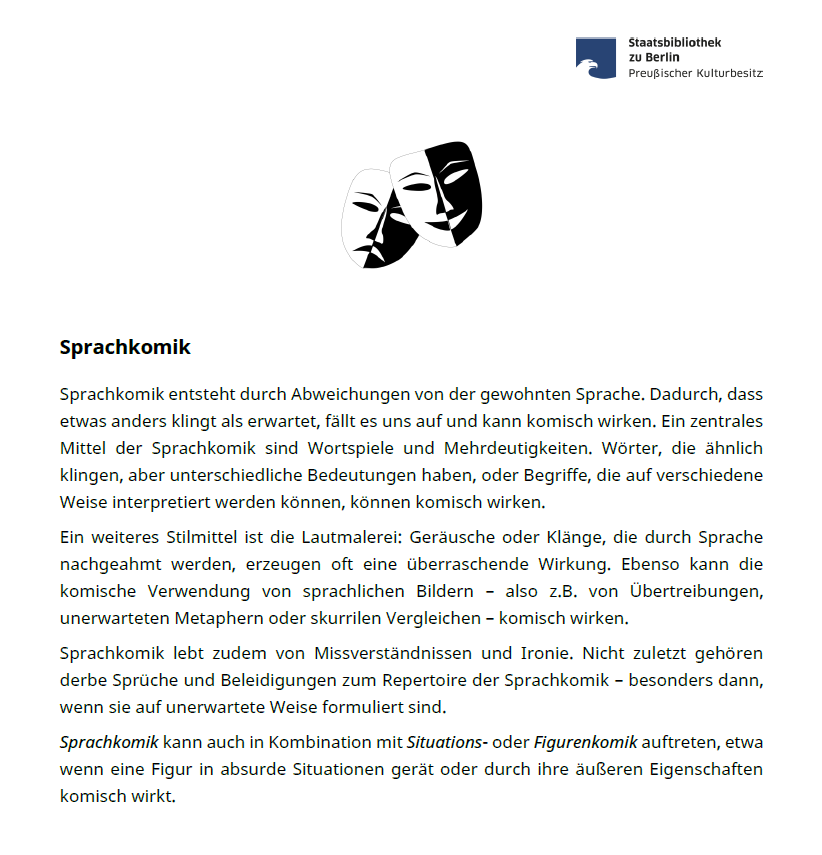
Infokarte A Sprachkomik (Pdf)
Infokarte B: Situationskomik
Infokarte C: Figurenkomik
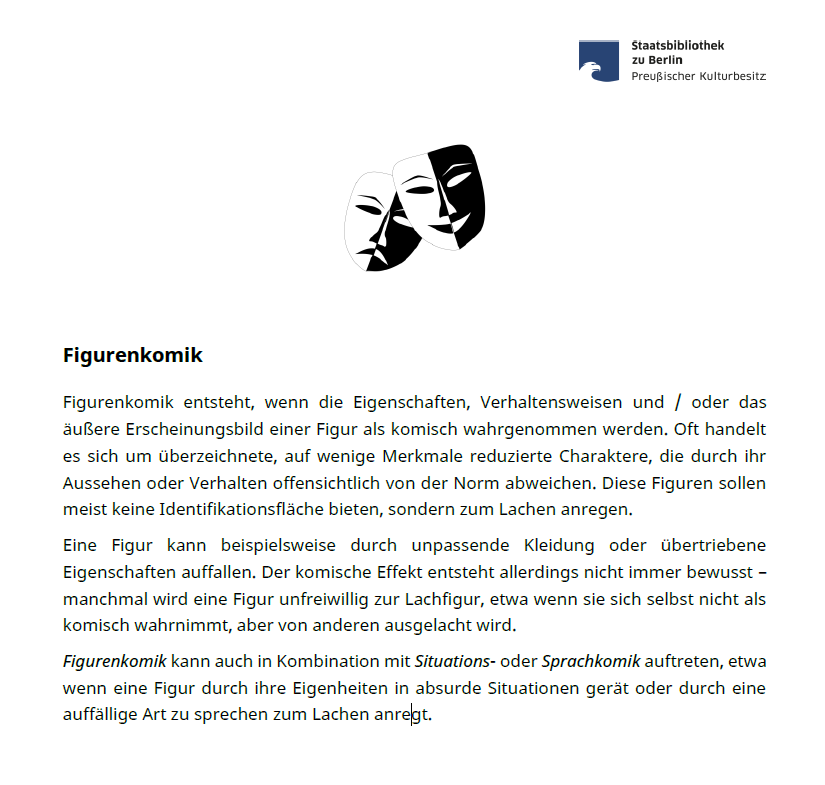
Infokarte C Figurenkomik (Pdf)
Arbeitsblätter Gruppen A – C (s.o.)
Infokarte A Sprachkomik (Pdf)
Infokarte B Situationskomik (Pdf)
Infokarte C Figurenkomik (Pdf)
Folien für den Unterricht (1-9) (Pdf): F4
Lehrkraft projiziert den Arbeitsauftrag an die Tafel (vgl. rechts: Folie 4 der Folien für den Unterricht):
Die SuS analysieren ihre Szene in Bezug auf Merkmale ihrer Komikart und halten ihre Ergebnisse im Anschluss auf ihrem Arbeitsblatt (in der „Tabelle“) fest. Die Lehrkraft unterstützt bei möglichen Fragen.
Lehrkraft eröffnet das Plenum: „Welche Fragen sind evtl. noch offen?“
Klassenzimmer wird umgebaut, Tische werden an den Rand geschoben.
Skript für die Lehrkraft (Pdf, S.2: „Warm up“)
Lehrkraft leitet „Warm-Up“ ein, schnelle Schulter- und Zungenübungen für eine gelungene Performance:
Übung 1: Schulterübung
Übung #1: Lockern Sie Ihre Schultern!
Stellen Sie sich aufrecht hinter Ihren Stuhl.
Ziehen Sie Ihre Schultern nach oben in Richtung der Ohren. Halten Sie diese dort für 2-3 Sekunden.
Lassen Sie die Schultern entspannt nach unten sinken und atmen dabei laut aus.
Wiederholen Sie diese Übung mindestens 5-mal.
Übung 2: Zungenübung
Übung #2: Schnalzen Sie mit der Zunge!
Ihre Zungenoberseite „klebt“ am oberen Gaumen.
Mit einem „Klack“ lassen Sie die Zunge schnell nach unten fallen.
Wiederholen Sie diese Übung mindestens 10-mal.
Folien für den Unterricht (1-9) (Pdf): F5, F6
Skript für die Lehrkraft (Pdf, S. 2: „Erarbeitung III“)
Lehrkraft präsentiert zunächst den nächsten Arbeitsauftrag (vgl. rechts: Folie 5 der Folien für den Unterricht):
Dann projiziert sie die Überlegungen für die Probe als Hilfestellung (vgl. rechts: Folie 6 der Folien für den Unterricht):
Sie führt diese aus, um den SuS das Rollenspiel zu erleichtern.
SuS proben ihre Szene.
5 Minuten vor Ablauf der Zeit weist die Lehrkraft auf die Generalprobe hin: „Spätestens ab jetzt müsst Sie Ihre Szene einmal komplett durchspielen, falls dies noch nicht geschehen ist.“
Folien für den Unterricht (1-9) (Pdf): F7, F8
Skript für die Lehrkraft (Pdf, S. 3: „Präsentation der Ergebnisse“)
Arbeitsblätter Gruppen A – C (s.o.)
Lehrkraft zeigt den Beobachtungsauftrag (vgl. rechts: Folie 7 der Folien für den Unterricht):
Diese Fragen sollen die jeweils zuschauenden SuS bei der Rezeption der anderen Gruppen beachten. Damit läutet die Lehrkraft die Präsentationsphase der Gruppen ein.
Die Gruppen stellen ihre erarbeitete Szene im Plenum vor.
Klasse gibt auf Grundlage des Beobachtungsauftrags Feedback zur Inszenierung und überlegt, welche Merkmale der vorgestellten Komikarten sie sehen konnten.
Die Gruppen begründen ihre Inszenierungs-Entscheidungen und stellen die Ergebnisse ihrer Analysearbeit vor.
Lehrkraft gibt Hinweise auf ein angemessenes Verhalten beim Zuhören (gegenseitiges Respektieren der künstlerischen Leistung etc.)
Das Arbeitsblatt Tabelle, das die SuS bereits vor sich haben, wird von der Lehrkraft in der Präsentation „live“ ausgefüllt (vgl. rechts: Folie 8 der Folien für den Unterricht). Die SuS ergänzen die leeren Tabellenspalten (auf ihren Arbeitsblättern) um die Arbeitsergebnisse der anderen Gruppen.
Es werden mögliche Abschlussfragen geklärt.
Eventuell kann ein Ausblick auf die anschließende Stunde (s.u.) erfolgen.
Lehrkraft bedankt sich für die Mitarbeit in der Stunde (vgl. rechts: Folie 9 der Folien für den Unterricht).
Skript für die Lehrkraft (Pdf, S. 3: „Abschluss der Stunde“)
Folien für den Unterricht (1-9) (Pdf): F9
Thema "MeToo"
Eine Verknüpfung mit der Lehreinheit „MeToo“ erscheint sinnvoll, insbesondere wenn die bis in unsere Gegenwart reichende kritische Komponente des Stücks näher diskutiert werden soll. Kleists „Lustspiel“ impliziert immer auch die sexuelle Lust Adams, und die Komik im Stück ist oft auf direkte Weise mit Machtstrukturen (sowie deren Verletzung) verbunden. Man denke in diesem Zusammenhang etwa an Adams intendierte (jedoch scheiternde) Verdeckung des Machtmissbrauchs, die sich oft als unfreiwillig komisch äußert oder den Autoritätsverlust des Richters durch den dreisten Karrieristen und Schreiber Licht: „Geschunden ist’s, / Ein Gräul zu sehn. Ein Stück fehlt von der Wange, / Wie groß? Nicht ohne Waage kann ich’s schätzen“ (Kleist 2024: V. 35-37). „Darf“ man als Leser/in und Zuschauer/in eines MeToo-Vorfalls bzw. eines juristischen Machtmissbrauchs denn überhaupt über Adams Verhalten lachen oder bleibt einem das Lachen nicht viel eher im Halse stecken? Schauen wir als Leser/innen eigentlich kritisch genug auf Adam, der sich gerade trotz „seiner Korruptheit, weitgehender Sympathie des Publikums sicher sein kann“ (Schneider 2013: 36)?
Folien für den Unterricht (1-9) (Pdf)
Arbeitsblatt A Sprachkomik (Tabelle + Textstelle A) (Pdf)
Arbeitsblatt B Situationskomik (Tabelle + Textstelle B) (Pdf)
Arbeitsblatt C Figurenkomik (Tabelle + Textstelle C) (Pdf)
Infokarte A Sprachkomik (Pdf)
Infokarte B Situationskomik (Pdf)
Infokarte C Figurenkomik (Pdf)
Skript für die Lehrkraft (Pdf)
Tabellarischer Verlaufsplan für die Lehrkraft (Pdf)
Erwartungshorizont der Tabelle (Pdf)
Sachanalyse (Pdf)
Didaktische Perspektivierung (Pdf)
Primärliteratur
Kleist, Heinrich von (2024): Der zerbrochne Krug [1811]. In: Bernd Hamacher (Hg.): Studienausgabe. Mit einem Nachwort und Anmerkungen von Alexander Košenina. Stuttgart.
Sekundärliteratur (s. auch „Sachanalyse“/ „Didaktische Begründung“)
Greiner, Bernhard (2013): Komödie. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 21-27.
Schneider, Helmut J. (2013): Der zerbrochne Krug. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 33-41.
Weiterführende Literatur
Balzter, Stefan (2013): Wo ist der Witz? Techniken zur Komikerzeugung in Literatur und Musik. Berlin.
Eisenberg, Benjamin (2020): Aspekte der Komik-Analyse: Wie entsteht Sprachkomik? Duisburg.
Kindt, Tom (2011): Literatur und Komik. Zur Theorie literarischer Komik und zur deutschen Komödie im 18. Jahrhundert. Berlin.
Wirth, Uwe (2017; Hg.): Komik. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart.

 #MeToo
#MeToo