„Das, was ich da wiedersah, war meine Heimat nicht mehr“. Aufarbeitung familiärer Traumata im Citizen Science-Projekt „Kriegsende 1945“
Im Mai 2025 hatte die Stabi im Rahmen unseres Citizen Science-Projekts einen Aktionstag zum Kriegsende 1945 veranstaltet, bei dem Familienerinnerungsstücke zum Digitalisieren in die Staatsbibliothek gebracht werden konnten. Die Berlinerin Sabine Lüder hatte davon im Tagesspiegel gelesen, war aber am Aktionstag verhindert. Und so wandte sie sich anschließend an uns und fragte, ob sie zwei sehr interessante Tagebücher ihrer Tante auch noch nachträglich beitragen könne.
Unser Digitalisierungszentrum sagte zu, dass man auch noch im Nachgang Materialien scannen könne, allerdings nur nach einer gewissen Quarantäne-Zeit, bei der die papiernen Zeugnisse aus Familienbesitz unter Beobachtung stehen mussten, um Papierschädlinge auszuschließen. Die Tagebücher von Frau Lüders Tante Rosemarie haben nicht nur Vertreibung und Flucht aus Vorpommern unbeschadet überstanden, sondern – dagegen ein Klacks – nun auch noch diese Prüfung. Und so konnten wir einige Zeit später die beiden Kladden mit Buntpapiereinband und sich wandelnder Handschrift in ihrer digitalisierten Form in die Datenbank Transcribathon hochladen, wo sie nun für die interessierte Öffentlichkeit und Forschung zur Verfügung stehen. Um die oftmals handschriftlichen Quellen zu erschließen, bieten wir seitdem Transkriptions-Workshops an, was auch für Frau Lüder zu einem Gewinn wurde:
Nachdem Frau Lüder die Tagebücher im Nachlass ihrer Tante nämlich überraschend gefunden hatte, hatte sie bereits versucht, die Schrift zu lesen und sich mit dem Leben der jungen Rosemarie zu beschäftigen, aber die ersten Abschnitte waren noch in Sütterlin geschrieben und damit für sie nur schwer entzifferbar. In einem unserer Transkriptions-Workshops ergab es sich, dass eine andere Teilnehmerin ihre Hilfe anbot und die Sütterlin-Passagen transkribierte. Nun sind alle Seiten der Tagebücher mit Transkription versehen und erzählen die Geschichte einer eigentlich vertrauten Frau, die Frau Lüder aber noch einmal ganz neu kennenlernen konnte. Über die erlittenen Traumate war in der Nachkriegszeit nicht gesprochen worden. „Ich würde Tante Rosemarie gerne so Vieles noch fragen“, sagt Frau Lüder. Hier ist ihre Geschichte:
Rosemarie – Das, was ich da wiedersah, war meine Heimat nicht mehr
Das Tagebuch meiner Tante
Ich schreibe hier über das Tagebuch meiner Tante, Rosemarie Lüder, das im Rahmen des Projektes „Transcribathon 1945“ veröffentlicht worden ist. Es beginnt 1940 mit einem Urlaub an der Ostsee mit einer Freundin und endet 1954. Inzwischen ist sie seit 3 Jahren verheiratet und lebt in Ludwigsburg.
Es ist eine in Teilen erschütternde Geschichte von Vertreibung und Flucht, aber es ist auch die Geschichte einer lebenslustigen jungen Frau, die gerne reiste, die die Natur kannte und liebte und die ungeheuer mutig war.
Rosemarie hat kein Innerlichkeitstagebuch geschrieben, eher einen Bericht über ihre Erlebnisse, manchmal erst Monate später aufgeschrieben, lakonisch, selten gefühlsbetont. Gefühle zeigen sich oft indirekt; sie gerät ins Schwärmen, wenn sie eine schöne Landschaft beschreibt, oder als sie sich an Rudertouren auf dem kleinen verwunschenen See erinnert, der zum Besitz ihrer Familie gehörte. Wut und Bitterkeit über den Verlust ihrer Heimat brechen sich im Tagebuch zwei-, dreimal Bahn, aber sie ist viel zu sehr damit beschäftigt, trotz allem weiterzumachen und sich ein Leben danach aufzubauen.
Rosemarie, 1922 geboren, war die ältere Schwester meines Vaters und meine Patentante. Sie wuchs auf Salzow, einem 270 ha großen Gutsbetrieb bei Löcknitz in Vorpommern, südwestlich von Stettin auf. Heute grenzen die Ländereien des ehemaligen Gutes an Polen.
Rosemarie war in meinen Augen eine beeindruckende Frau. Sie war sehr groß, schlank, trug ihre blonden Haare zu einer „Banane“ frisiert, was bei ihr sehr elegant aussah. Sie kleidete sich gut und besaß schönen Schmuck. Sie machte interessante Reisen in weit entfernte Länder. Von diesen Reisen brachte sie mir meistens ein Schmuckstück mit, Schmuck, der mir immer gefallen hat und den ich noch heute trage.
Kurz vor meinem 3. Geburtstag, 1962, wurde ich für 6 Wochen zu Rosemarie nach Ludwigsburg geschickt, als die Geburt meines Bruders ins Haus stand. Ich erinnere mich an ein sehr schönes Haus mit grünen Fensterläden, an eine Hollywoodschaukel im Garten, an eine Weißdornhecke, deren Duft noch heute Erinnerungen an etwas Schönes in mir hervorruft. An den schwarzen Cockerspaniel namens Bongo. An Rosemaries Mann, Franz, mit dem sie damals noch verheiratet war, erinnere ich mich kaum, dafür an Dieter, Franz‘ Sohn aus erster Ehe. Rosemarie kaufte mir ein Dirndl, auf das ich sehr stolz war. Und sie spazierte mit mir durch Ludwigsburgs Schlossgarten.
Vor Kriegsende
In meiner Familie kursierte die Legende, Rosemarie habe es schwer gehabt, einen Mann zu finden, weil sie eine ungewöhnlich große Frau war. Wer ihr Tagebuch liest, erfährt, dass das nicht stimmt. Dort ist schon früh von Verehrern und Heiratsanträgen die Rede, eher nebenbei, kurz erwähnt. Sie sehnte sich lange nach Karl Heinz, einer Liebe, die offenbar vor dem Tagebuch begann. Dieser wurde im Krieg vermisst und dann wahrscheinlich für tot erklärt.
Rosemarie machte nach dem Abitur und einem sogenannten Pflichtjahr in Ostpreußen eine Ausbildung zur Biologisch-technischen Assistentin in Landsberg an der Warthe. War es damals üblich, dass „höhere Töchter“ eine Berufsausbildung machten? Das gab ihr die Möglichkeit, viel Zeit in der Landschaft zu verbringen. Dank ihrer Ausbildung fand sie nach dem Krieg relativ schnell Arbeit – in Heidelberg im Amerikanischen Sektor, wohin sie unbedingt wollte und was ihr mit Hilfe einer kleinen Trickserei gelang. Ihr Bruder, mein Vater, war zwar als zukünftiger Erbe Salzows von seinem Vater in die Landwirtschaft eingeführt worden, war aber nach dem Notabitur mit 17 Jahren eingezogen worden. Er hatte also keine Ausbildung und arbeitete noch 1948 als Knecht auf einem Hof in Schleswig-Holstein, was Rosemarie Sorgen bereitete.
1944 reist Rosemarie nach Wien, um sich auf eine Arbeitsstelle zu bewerben. Die Schilderung dieser Reise ist spannend zu lesen; Züge fallen aus, werden umgeleitet, sind überfüllt. Außerplanmäßig muss Rosemarie in Breslau übernachten. Trotz des Chaos‘ erfreut sie sich an den Landschaften, die sie unterwegs sieht. Auf dieser Reise erwähnt sie erstmalig den Krieg: einer der Züge ist überfüllt mit Flüchtlingen aus Litauen. Auf der Rückfahrt sieht sie das zerbombte Berlin, in ihren Augen ein „Terrorakt“ der Alliierten. Beim Lesen dieser Stelle zieht sich mir der Magen zusammen. In allen Kriegen sind immer „die Anderen“ die „Terroristen“, selbst wenn man selbst den Krieg begonnen hat…
Wien gefällt Rosemarie ausnehmend gut, obwohl sie anfänglich keine Unterkunft findet und improvisieren muss. Neben den Gesprächen im Institut besucht sie die Sehenswürdigkeiten. Sie kann sich gut vorstellen, dort zu leben. Wie kommt ein Landkind wie Rosemarie dazu, in einer Großstadt leben zu wollen? Warum so weit entfernt von ihrem Zuhause?
Ich würde sie gern so Vieles fragen.
Die Stelle in Wien darf sie nicht antreten, weil zunächst Einheimische Arbeit finden sollen.
Der Krieg kommt nach Salzow
Kurz vorher hatte die Familie noch einen Fluchtversuch unternommen. Es war aber kein Durchkommen auf ihrer Route, und ein Großteil ihrer Besitztümer einschließlich einiger Pferde wurde ihnen gestohlen. Sie kehrten also wieder um. Um Löcknitz wurde ein absurder Verteidigungskampf geführt, bis die Stadt dann von der russischen Armee besetzt wurde. Besetzt wurde auch Salzow, die Familie wurde enteignet und musste ihr Haus verlassen. Rosemarie und ihre Mutter wurden einige Mal vergewaltigt. Auch dies erwähnt sie ohne weiteren Kommentar. Die Familie kam bei Freunden in Löcknitz unter; Rosemarie versteckte sich und verließ das Haus zunächst nicht. So erfuhr sie durch ihre Mutter, dass ihr Vater von zwei jungen russischen Soldaten erschossen worden war. Ihre Mutter wurde ebenfalls verletzt. Es hatte einen Verrat oder Racheakt eines ehemaligen Arbeiters des Gutes gegeben.
Als Rosemarie einige Tage später nach Salzow läuft, findet sie ihr Zuhause verwüstet vor, Müll und menschliche Exkremente in den Wohnräumen, die Möbel verschwunden.
1946 fährt Rosemarie – sie lebt inzwischen mit ihrer Mutter und zwei Tanten sehr beengt in einem Zimmer in Lübeck – zurück nach Osten. Sie möchte Besitztümer holen, die sie auf der Flucht im Wald an der Ostsee vergraben hatte. Diese Reise ist noch abenteuerlicher als jene nach Wien. Für jede Besatzungszone benötigt sie Passierscheine, die Reisenden werden in Barackenlagern untergebracht, gegen Läuse behandelt, werden aber gut verpflegt: „Kohlsuppe und für jeden ein Ei“. Rosemarie lernt eine junge Frau kennen, Irmgard, die auf dem Weg in ihr altes Zuhause in Rostock ist und eine lebenslange Freundin werden wird. Irmgard will – wie Rosemarie – unbedingt in den Amerikanischen Sektor umsiedeln.
Überhaupt lernt Rosemarie schnell Menschen kennen und bleibt mit ihnen in Kontakt.
Die Züge sind so überfüllt, dass sie manchmal auf dem Dach mitfahren; auf einer Strecke stehen sie mit sechs Anderen in einer Toilette. Sie übernachten auf Bahnhöfen, zu zweit unter Rosemaries Bettdecke, die sie aus Lübeck mitgebracht hat.
In Mönkebude an der Ostsee findet Rosemarie zwar die Stelle im Wald, wo sie auf der gescheiterten Flucht den Schmuck – und was auch immer sie vergraben hatte –, aber sie findet nur noch ein verkohltes Stück eines Ahnenpasses. Wie absurd; Ahnenpässe werden jetzt am wenigsten benötigt.
Salzow ist in einem noch verwahrlosteren Zustand als vor einem Jahr. Im Gutshaus wohnen Fremde, das Land ist aufgeteilt, die Scheunen leer, die Tore hängen in den Angeln. „Nur weg, fort hier, ich konnte es nicht ertragen und floh wieder weg. Das, was ich da wiedersah, war meine Heimat nicht mehr.“
Sie nimmt sich vor, Salzow so zu erinnern, wie es früher war.
Nach dem Krieg
Rosemarie kommt erstaunlich schnell in ihrem neuen Nachkriegsleben an. Sie arbeitet in Heidelberg in ihrem Beruf, verbringt zwei Sommer in der Nähe des Schwarzwaldes, um Obstbaumschädlinge zu bekämpfen. Sie macht Ausflüge mit dem Fahrrad, und in ihrem Urlaub fährt sie per Anhalter in die Alpen und geht dort wandern. Sie ist begeistert von der Vegetation, der Bergkulisse und den Sonnenauf- und -untergängen. Und sie geht schwimmen, wo immer es Wasser gibt. Sie ist ja am Löcknitzer See – mit einer Badeanstalt, die es heute noch fast unverändert gibt – aufgewachsen.
Inzwischen hat sie neue Verehrer gefunden. Keiner ist „der Richtige“. Dann taucht ihr zukünftiger Mann, zunächst nur als F.M., im Tagebuch auf, der dann schnell zu „Franzl“ wird, und mit dem sie viel in seinem Auto unterwegs ist, Messen, Cafes, Restaurants und Tanzlokale besucht. Einige schlechte Manieren möchte sie ihm noch abgewöhnen. Aber sie ist sehr verliebt in ihn. Noch vor der Heirat gibt Rosemarie ihre Arbeit auf und zieht nach Ludwigsburg, wo sie sich um Franzls sehr rudimentären Haushalt kümmert, eine Wohnung, später ein Haus einrichtet – das Haus, in dem ich Jahre später als Dreijährige zu Besuch war. Und sie arbeitet in Franz‘ Firma (er ist Physiker und stellt u.a. Motoren für Kinderspielzeug her) im Büro. Sie schreibt so, als sei sie zufrieden. Angekommen.
Wann und warum Rosemarie und Franz sich haben scheiden lassen, habe ich nie erfahren. Ich war noch zu klein und später habe ich nicht gefragt. Das Tagebuch gibt keine Auskunft. Es endet abrupt; die letzten 15 Seiten des zweiten Bandes sind leer.
Materiell ging es Rosemarie gut. Sie bekam jahrzehntelang einen hohen Unterhalt von Franz, sie lebte weiter in Ludwigsburg in einer Eigentumswohnung, arbeitete in einem Büro und konnte es sich leisten zu reisen.
Aber wirklich erfüllt oder glücklich wirkte sie nicht. Anders, als ich sie in ihrem Tagebuch kennenlernen durfte. Vielleicht hat der zweite große Verlust ihres Lebens, nach Salzow noch der ihrer Ehe, ihrer Lebensfreude einen Knacks gegeben?
In meiner Familie war der Verlust von Salzow ausgesprochen oder unausgesprochen immer präsent. Meine Eltern waren mit dem Kindheitsfreund meines Vaters und seiner Frau eng befreundet und fuhren häufig nach Greifswald, dem Wohnort dieser Freunde, und nach Salzow. Auch Rosemarie war noch mindestens einmal, gemeinsam mit meinem Vater, dort.
In der Stasiakte meines Vaters wurde der Verdacht geäußert, er sei ein Westspion, unter anderem, weil er auf Salzow und in Löcknitz fotografierte. Wie wenig Menschenkenntnis daraus spricht! Er war doch nur ein älterer Mann, der seine Heimat besuchte und Erinnerungsfotos machte.
1976 fuhren wir als Familie nach Salzow. Ich hatte Glück, das Gutshaus noch sehen zu können. Es wurde kurze Zeit später abgerissen. Die

Sabine Lüder / Privataufnahme
Eingangstreppe war marode, die Fenster und die Treppe ins Obergeschoss waren kaputt. In einem Raum – dem „rosa Salon“ – lag eine schmutzige Couch auf dem Rücken.
Mein Vater wirkte unendlich traurig, und ich war es auch.
Alle paar Jahre fahre ich mit meinem Mann oder meiner Freundin nach Löcknitz. Es gibt ein kleines Hotel am See. Wir fahren Rad oder gehen spazieren. Und wir gehen natürlich in dem See schwimmen, in dem schon Rosemarie und ihre beiden Brüder einen Teil ihrer Kindheit verbracht haben.
Auf der gegenüberliegenden Seeseite liegt Salzow.
Oktober 2025, Sabine Lüder
Haben wir Ihr Interesse am Projekt geweckt? Haben Sie ebenfalls Lust, sich mit den Quellen aus der Nachkriegszeit zu beschäftigen? Vorkenntnisse sind nicht erforderlich Melden Sie sich gerne unter mitforschen@sbb.spk-berlin.de
Oder nehmen Sie an unseren Workshops teil:
Alle Termine finden Sie regelmäßig auf unserer Seite:
lab.sbb.berlin/erinnerungen1945/Mehr zu unseren Citizen Science-Projekten finden Sie im Stabi Lab:
lab.sbb.berlin/citizen-science
In Zusammenarbeit mit Facts & Files Historisches Forschungsinstitut Berlin und Facts & Files Digital Services GmbH und Europeana.

Teil der stadtweiten Themenwoche 80 Jahre Kriegsende auf Initiative und gefördert vom Land Berlin, realisiert von Kulturprojekte Berlin mit zahlreichen Partnern.



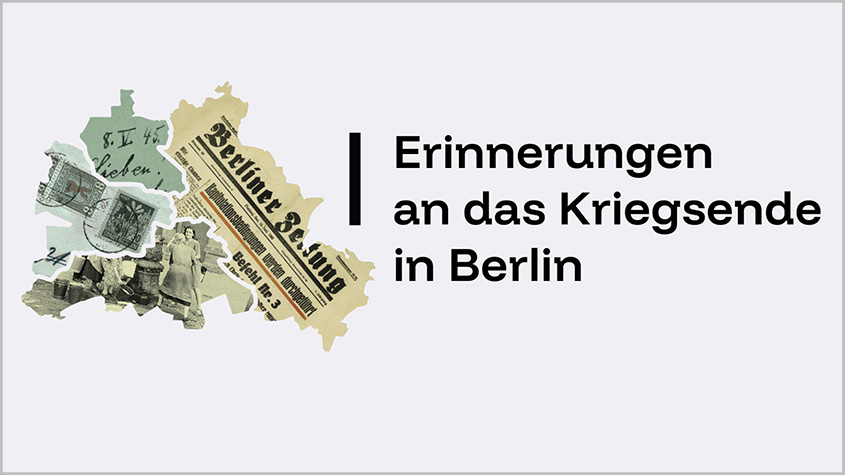






Ja sehr interessant , berührend , die Geschichte meiner Berliner Eltern ist auch von Flucht , Verlusten , Trennungen geprägt , ich würde auch gern Kontakt zu dem Projekt aufnehmen , Jörg Graßmann, ein Freund von Sabine
Lieber Herr Graßmann, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Citizen-Science-Projekt und schön, dass Ihnen der Blogpost Ihrer Freundin und gleichzeitig unserer Beiträgerin und Citizen Scientist Sabine Lüder den Anstoss gibt, vielleicht auch die Geschichte Ihrer Eltern zu teilen. Wenn Sie noch Familienerinnerungsstücke aus den Jahren 1945-1950 besitzen, melden Sie sich gerne bei uns. Wir könnten diese noch in die Datenbank https://1945.transcribathon.eu/ hochladen und in unserem Workshops (zu denen Sie auch herzlich eingeladen sind) die handschriftlichen Stücke entziffern. Nähere Informationen finden Sie hier: https://lab.sbb.berlin/erinnerungen1945/
Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse mitforschen@sbb.spk-berlin.de
Mit besten Grüßen, Ulrike Reuter