Zwischen Lust & Last – zeithistorische Forschungen & Onlineportale. Vortrag anlässlich der Präsentation des DDR-Presseportals am 27. Juni 2013
Ein Gastbeitrag von Dr. Ilko-Sascha Kowalczuk (Stasi-Unterlagen-Archiv/Bundesarchiv) in unserer vierteiligen Blogserie ‚… und der Geschichte zugewandt‘ – 10 Jahre DDR-Presseportal in persönlichen Rückblicken.
Sehr geehrte Damen und Herren,
stellen wir uns einmal vor, hier säßen auch normale Menschen herum, also Leute, die bei dem Begriff „DDR-Zeitungen“, noch dazu „Neues Deutschland“, reagieren, wie normale Menschen, nämlich den gestreckten Zeigefinger mehr oder weniger diskret in Richtung Stirn zu heben – stellen wir uns das einmal vor, so wäre und ist doch eigentlich erklärungsbedürftig, warum wir uns heute hier versammelt haben, warum wir alle so froh gestimmt sind, warum wir uns alle so freuen, ob nun als Bibliothekare oder Bibliophile, als Forschende oder Journalisten, als Historiker oder sonst wie leicht Abnorme. Wir reden hier über drei Tageszeitungen, die etwa zwischen 1950 und Mitte 1989 – um es freundlich auszudrücken – ziemlich ähnlich waren. Die älteste ist die „Berliner Zeitung“ (21.5.1945), dann kam ein paar Wochen später die „Neue Zeit“ (22.7.1945) hinzu, das „Neue Deutschland“ ein knappes Jahr später. Vielleicht sitzt ja doch jemand hier herum, der sich dafür interessiert, warum zum Beispiel ich mich so freue, jetzt endlich so modern recherchieren zu können. Darüber werde ich ein bisschen reden, ohne völlig im Feiertaummel aufzugehen, unterzugehen – wie auch immer Sie wollen.
Denn: Ich bin in einem echten Zwiespalt. In mir kämpfen zwei Seelen: der Bücher- und Bibliotheksnarr einerseits und der von ständigen Terminnöten bedrängte Forscher und Publizist andererseits. Ich konnte mich nicht entscheiden, welcher Seite ich in diesem Vortrag Vorrang einräume. Deshalb erzähle ich Ihnen einfach von beiden und von dem Clinch, den beide ständig miteinander austragen. Und wahrscheinlich kommt dabei etwas heraus, womit Sie nicht unbedingt rechneten in diesem Festvortrag.
Zunächst einmal darf ich Ihnen verraten, dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass ich zu Ihnen heute hier überhaupt rede und reden darf. Es muss so etwa 1986 gewesen sein, als ich von der Staatsbibliothek Ost als regulärer Leser gestrichen wurde, ich will nicht sagen, ich hätte Hausverbot erhalten, aber mein Benutzerausweis ist für ungültig erklärt worden, was ja irgendwie auf das Gleiche hinauslief. Ich hatte etwas getan, was einem heute etwas merkwürdig vorkommen mag, ich hatte mich schriftlich beschwert, dass ich bestimmte Bücher nicht lesen durfte – ich wollte sie nicht einmal ausleihen, ich wollte sie in einem Lesesaal lesen. Ich wurde unterrichtet, dass ich mich an die Benutzerordnung zu halten habe und wenn ich diese nicht akzeptiere, würde ich den Status eines Lesers, sprich Benutzers verlieren. Ich schrieb zurück, dass ich doch eine Bibliotheksordnung nicht akzeptieren könne – vorausgesetzt ich habe alle Tassen im Schrank –, die mir das Lesen bestimmter Bücher von vornherein untersagt. Ich möchte sagen, meiner Erinnerung nach, ich bekam dafür in der Rückantwort durchaus verständnisvolle Worte, die aber nichts daran ändern konnten, dass ich nun gar nichts mehr lesen dürfte in der Staatsbibliothek Ost – nebenbei gesagt, als Leser der Staatsbibliothek West war ich ganz ohne jegliches Zutun der Staatsbibliothek als Leser ohnehin a priori ausgeschlossen.
Nun wollte ich mich damit dennoch nicht zufrieden geben, von der Ost-Staatsbibliothek ausgeschlossen geworden zu sein, und ging ein paar Wochen später in diesem Jahr 1986 zu dem ehrwürdigen Haus Unter den Linden und dachte, ich bin ein ganz Schlauer. Ich meldete mich in der Anmeldung, wo die dortigen Beschäftigten meiner Erfahrung nach sich von der Kundenfreundlichkeit durchschnittlicher Kellner und Kellnerinnen in der DDR leider nicht sonderlich abhoben und erklärte dem gelangweilten Personal nun, ich dürfte zwar hier nicht mehr lesen, aber ich denke, sie würden bestimmt heute eine Ausnahme machen. Schlau wie ich dachte zu sein, sagte ich, sie könnten mir doch nicht verwehren – unter gar keinen Umständen – mir ausnahmsweise heute zu gestatten, bei ihnen das SED-Zentralorgan „Neues Deutschland“ zu lesen. Ehrlich, ich weiß nicht mehr, ob ich mehr oder weniger aktuelle Ausgaben oder irgendwelche Ausgaben aus den 1950er Jahren einsehen wollte. Mir ging es um die Ausnahme, überhaupt etwas zu erhalten, so dass ich mich später auf diese Ausnahmeregelung berufen könnte. Ich war wahrscheinlich doch nicht schlau genug. Etwas pampig teilte mir eine dieser mürrischen Frauen mit, ihr sei es ziemlich egal, was ich lese wolle, hier bekäme ich gar nichts. Ich hatte mich darauf durchaus vorbereitet und entgegnete schlagfertig und voller Witz: Sie wollen mir doch nicht sagen, dass Sie mir verbieten, das „Neue Deutschland“ zu lesen. Sie allerdings dachte gar nicht daran, sich mit meiner Subversivität auseinanderzusetzen. Sie verbiete mir gar nichts, entgegnete sie kühl, sie gestatte mir nur nicht, dieses Haus zu betreten, wofür sie freilich nichts könne, und wenn ich nicht schnell verdufte, könne es noch ganz unangenehm für mich werden. Offenbar war es für sie nicht vorstellbar, dass dies alles ohnehin schon ziemlich unangenehm für mich war. Ich ging, freilich nicht ohne meine vorbereitete Pointe in den leeren Raum zu trompeten, so sieht es also aus, man verbiete mir in der DDR-Staatsbibliothek unser „Neues Deutschland“ zu lesen.
Kleine Zwischenbemerkung: Ich arbeitete damals als Pförtner in einem kleinen agrarwissenschaftlichen Forschungsinstitut. Da es dort eigentlich keine Pförtner gab – jedenfalls bis zu meinem Erscheinen – war ich zunächst in den Augen der meisten dort Angestellten logischerweise ein junger Stasi-Schnösel. Da den meisten – irgendwie hoffe ich, irgendwann allen – allerdings irgendwann aufging, dass sie mich in meiner Glasvitrine mehr beobachten konnten als ich sie, zerstreuten sich bald die Gerüchte über meine angebliche institutionelle Anbindung. Die dortige Bibliothek hatte nicht sehr viel für mich zu bieten, bis ich der Bibliothekarin meine Geschichte mit der Staatsbibliothek erzählte. Die lachte sich halbkrank und sagte, na, denen zeigen wir es aber. Sie sonderte zunächst die ganzen stalinistischen Politwerke aus und freute sich, in mir einen dankbaren Abnehmer gefunden zu haben, der sich diebisch über dieses unmögliche Zeug freute. Die Frau hatte einen Ausreiseantrag zu laufen. Sie händigte mir nun außerdem, wann immer ich es wollte, den Kooperativausweis dieses Instituts für die Stabi aus – womit praktisch alle Benutzungsschranken fielen und ich selbst vom Ausgeschlossenen zum Privilegierten wurde.
Nach dem Mauerfall habe ich bei der Stabi keinen Antrag auf Rehabilitierung, sondern habe einfach wieder einen Benutzerantrag gestellt, bekam diesen ohne Aufheben und fühlte mich vollständig rehabilitiert.
Nun verlor ich allerdings eine Angewohnheit trotz Mauerfalls und Archiv- und Bibliotheksöffnungen nicht: möglichst alles, in welcher Form auch immer, was ich für relevant hielt, selbst zu haben, ich will nicht von Besitzen sprechen, sondern so zu haben, dass ich jederzeit darauf zurückgreifen könne – ob nun wegen der Öffnungszeiten oder weil sich vielleicht doch noch mal jemand anmaßt, dieses oder jenes in Giftschränken wegzuschließen oder jenes oder dieses in den Archiven nicht mehr als frei zugänglich zu erklären. Man weiß ja nie – ich kann selbst nichts für die Angewohnheit, jedenfalls erkläre ich mir meine papierne Sammelwut mit dieser Sozialisationserfahrung, wie diese Macke in Uniseminaren etwas abgehoben bezeichnet wird. Ich bin so etwas wie ein strukturiert sammelnder temporärer Messi, der allerdings von Zeit zu Zeit die ganz wichtigen Papierberge, die völlig verstaubt sind, doch einfach wegschmeißt, weil ich nicht einmal mehr weiß, was unter dem Staub sich alles so verbirgt. Das war zu DDR-Zeiten manchmal etwas unangenehm, weil mich fast alle meiner Freunde für einen Freak oder doch einen verkappten Kommunisten hielten, denn ich sammelte auch das ganze rote Zeug, ganz ohne Ansehen des Inhalts – anders ging es ja auch gar nicht. Und meinen Erklärungen, man müsse den Typen das eines Tages alles um die Ohren hauen und vor Augen führen, glaubte ich damals wahrscheinlich nur einen Deut mehr als es mir meine Freunde nicht glaubten. Aber ich sammelte und schaffte es mit Hilfe eines Heizers zudem, Originaldokumente vor dem Feuer zu retten: zwei Kapitel meiner späteren Dissertation basierten auf diesem Zeug.
Für einen blindwütigen Sammler wie mich waren dann die Jahre 1990 und 1991 unentwegt von Höhepunkten charakterisiert. Nicht nur, dass ich mein nicht vorhandenes Geld sehr clever unentwegt in Archiv- und Buchkopien anlegte. Mein Sammlerherz hüpfte fast ständig, weil ungezählte Institutionen und Einzelpersonen ihre Erblasten aus der gerade zu Ende gegangenen Epoche los werden und möglichst geräuschlos verschwinden lassen wollten. Buchstäblich über Nacht hatte ich alle fehlenden Bände der Marx-Engels-Ausgabe ebenso zusammen wie die der Lenin-Ausgabe, die unvollendete Stalin-Ausgabe ebenso wie Luxemburgs- oder Mehrings-Werke, natürlich auch die so genannten ersten Klassiker-Ausgaben der Nachkriegszeit, die ganzen SED-Parteitags- und Parteikonferenzenbände ebenso wie die Edition der SED-Dokumente und vieles andere an kommunistischer – wie wir heute sagen können – Primärliteratur. Aber nicht nur das, auch die ganzen Werke der parteitreuen Philosophen, Historiker, Soziologen, Literatur- und sonstiger Wissenschaftler lagen auf einmal im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße und mussten nur eingesammelt werden. Ich tat es eifrig und sparte mir seither so manchen Weg in die Bibliothek, weil ich bei dieser Gelegenheit auch gleich noch komplette Zeitschriftenreihen mit abgriff.
Nun spricht sich so eine Sammelwut selbst unter Geschichtsstudierenden herum, zu denen ich seit 1990 zählte. Da gab es noch so einen Freak. Der lud mich eines Tages in seinen Keller ein und zeigte mir Berge von Büchern, wie er sagte, etwa 8000 Stück. Die stammten aus der aufgelösten Bibliothek der aufgelösten Sektion Marxismus-Leninismus der fast in Auflösung begriffenen Humboldt-Universität zu Berlin. Er lockte mich mit dem Versprechen in seinen Keller, ich könne mitnehmen, was ich haben wollte. Nach einer halben Stunde allerdings wusste ich, dass der genauso durchgeknallt war wie ich selbst. Immer wenn ich mir einen Band greifen wollte, nahm er ihn kurz prüfend in die Hand und meinte sehr entschlossen, diesen nun gerade will er selbst behalten. Nach dem gefühlten hundersten Reinfall für mich, brach ich ab und sagte, er solle sich einfach nochmals melden, wenn er wüsste, was er behalten und was abgeben wolle. Er meldete sich nie wieder – also jedenfalls nicht wegen dieser Schätze in seinem Keller. Wenige Wochen später aber sprach er mich an und meinte, er hätte da etwas ganz Heißes am Laufen, aber dafür reiche sein Lagerplatz nicht mehr aus. Ich hatte gelernt und war vorsichtig, blieb auf kühler Distanz. Worum gehe es? Aus den Beständen der Sektion Marxismus-Leninismus gibt es noch einen kompletten, gebundenen Bestand „Neues Deutschland“ – vom 23. April 1946 bis zum 31. Oktober 1990. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Aber ich hatte gelernt und blieb nicht nur cool, sondern auch einigermaßen desinteressiert.
Sie ahnen schon, was jetzt kommt: nach einigen Verhandlungen, die wahrscheinlich weitaus unkomplizierter verliefen als ich es in Erinnerung habe, war klar, dass diese gebundenen Dinger in meinen Privatbesitz wandern. Ich habe, meiner Erinnerung nach, vier Freunde gebeten, mir beim Transport zu helfen. Wir borgten bei einer stadtbekannten LKW-Verleihfirma 1991 einen Pritschenwagen aus, fuhren zur Kommode auf dem Bebelplatz und hievten die Dinger auf den Klein-LKW. Was musste ich mir angesichts der Plackerei von NDs alles an Witzen gefallen lassen – von meinen Freunden. Dann fuhren wir in den Prenzlauer Berg in meine Hinterhofwohnung. Den Klein-LKW parkten wir in der Einfahrt, um den Transportweg zu minimieren. Wir schleppten die Dinger hoch, nicht ohne dass ich mir unentwegt immer wieder die sich nun wiederholenden Spötteleien gefallen lassen musste. Als endlich alles ausgeladen war, versicherten mir alle, für meinen nächsten Umzug unter gar keinen Umständen zur Verfügung zu stehen. Wir hatten dann nur noch ein Problem zu lösen – wir bekamen den LKW nicht mehr aus der Ausfahrt herausgefahren, weil er buchstäblich zwischen Erde und Decke festhing. Die ND-Last hatte ich unterschätzt – nicht einmal Luftablassen nütze etwas. Wir sprachen ein paar Leute auf der Straße an. Als die Pritsche mit unbekannten Menschen ansehnlich gefüllt war, rollte der Wagen heraus – auf die Bemerkung, so ganz sind wir immer noch nicht frei mit dem Auto, entgegnete ich geschäftsmäßig kühl, wer klettert bei der Rückgabe eines Pritschenwagens schon mit der Leiter aufs Dach…
Nun hatte ich also das „Neue Deutschland“ in meiner schäbigen Wohnung – komplett, gebunden, unendlich schwer. Als mir wenig später ein anderer Buchfreak erzählte, er kenne jemanden, der jemand kennt, dessen Freund einen Freund hat, dessen Hinterhauswohnung in den 1970er Jahren unter der Last von Büchern kurzerhand einen Etage nach unten krachte, rannte ich nach Hause und begann endlich, die tragenden Wände mit Regalen für das ND zu versehen.
Zwei Jahre später zog ich um – und nahm die NDs mit. Meine Freunde hatten doch alle Zeit und ich war nun ganz erfahren und lud noch weitere ein, so dass wir zu zehnt oder zwölft die Bücherkisten und die NDs runterschleppten, um sie ein paar Straßen weiter wieder raufzuschleppen. In der geräumigeren Wohnung stand nun vor der Wand mit den NDs ein altes, potthässliches Ostsofa – fast nur Betrunkene außer mir selbst wagten es, dort zu schlafen. Die meisten hatten den immer gleichen Witz auf Lager: am Ende doch noch vom ND erschlagen zu werden, das werde ich den Kommunisten nicht gönnen. Nun gut, als wir vor dem dritten Kind doch noch mehr Platz in unserer Wohnung benötigten, überredete mich meine Frau mit für Sammler offenkundig aberwitzigen Argumenten, dass ich die Dinger abgeben müsse – ich tat es mürrisch und seither, seit 2003, stehen sie in den Räumen der Robert-Havemann-Gesellschaft. (Nebenbei: Natürlich nur als Dauerleihgabe – dies nur als Anmerkung, falls hier unter Ihnen auch Freaks sein sollten: die verstehen dann schon diese Nebenbemerkung.)
Vielleicht mag sich mancher Nicht-Freak wundern, was ich Ihnen hier so erzähle und was das mit unserem Thema heute zu tun hat. Ich finde, eine ganze Menge. Denn ich bin ja nicht nur Sammler, sondern auch Forscher. Was tat ich nun mit dieser gewaltigen, schweren Quellensammlung in meinen Wohnungen. Jede Nacht nach getaner Arbeit, ich will nicht sagen Tag für Tag, sage aber Tag für Tag, nahm ich mir mit einem Glas Wein – anders geht das wirklich nicht – einen gebundenen Band zur Hand, legte ihn auf einen schönen alten Holztisch und fing an zu blättern, zu lesen. Manche Bände umfassen einen, andere zwei, einige Jahrgänge der 1960er Jahre auch drei Monate. Ich las nicht wahllos, hatte so meine Themen, die mich interessierten, an denen ich auch archivmäßig dran war.

Aber, und spätestens jetzt bin ich endlich beim Thema unseres heutigen Abends, ich nahm die historische Zeitung in ihrer ganzen Breite wahr. Ich las, was mich interessierte, las noch mehr, was mich nicht interessierte, sah, wie ein bestimmter Artikel platziert war, nahm die Seitenzahl nicht als bibliographische Angabe wahr, sondern erarbeitete sie mir. Ich sah Anzeigen und Annoncen, las unentwegt von Dingen, die mir fremd waren, mir wurde vieles bewusst und bekannt, was mir nicht nur zuvor fremd, sondern völlig unbekannt war.
Die Zeitung veränderte auch auf andere Weise meine Wahrnehmung. Es dauerte nicht lange, bis die Zimmer, in denen die ND-Ausgaben in den beiden erwähnten Wohnungen herumstanden, einen ganz eigentümlichen Geruch angenommen hatten – den kannte ich bis dato eigentlich nur aus dem für mich ohnehin immer schönsten, besten Lesesaal in der alten Staatsbibliothek Unter den Linden – den großräumigen Zeitungslesesaal. Aber nicht nur der Geruch, auch die Veränderung des Papiers im Laufe der Jahrzehnte konnte ich sinnlich wahrnehmen. Das Papier der 1940er und frühen 1950er Jahre erinnerte an Ausgaben des Kaiserreichs und der Weimarer Republik, das Papier der 1970er und 1980er Jahre eher an die Witze über das DDR-Toilettenpapier. Sie kennen den damals witzelnden Volksmund: „Warum ist das Toilettenpapier in der DDR so hart?“ Die Antwort fiel wenig vornehm aus: „Damit aus dem letzten ‚braunen’ Arsch auch noch ein ‚Roter’ wird.“ In diesem Witz ist auch der alltägliche schmerzhafte Toilettengang, bei dem man sich schon einmal Splitter unter die Haut schieben konnte, nicht nur von der Klobrille, sondern auch mit dem harten Papier, verarbeitet worden. Innerlich beleidigt waren die meisten Menschen dennoch, wenn ihre Verwandten aus dem Westen sich bei ihren Besuchsreisen hautfreundlicheres Toilettenpapier mitbrachten. Weniger beleidigt freilich waren die meisten, wenn sie sich über das ND lustig machten – das taten auch vielen im Osten: Ein Witz lautete so: „Jeden Morgen kauft ein Mann am Kiosk ein ND, schaut auf die erste Seite und wirft die Zeitung dann in den Papierkorb. Eines Tages spricht die Zeitungsfrau ihn an. ´Ich verstehe Sie nicht. Sie werfen nicht mal einen Blick auf die Lokalseite oder die Sportberichte, warum kaufen Sie die Zeitung überhaupt?` `Wegen der Todesanzeigen.` `Aber die stehen doch hinten.` `Die mich interessieren, stehen auf der ersten Seite.`“
Wenn Historiker und Historikerinnen zu Zeitungen als empirischer Quelle greifen, sind sie m.E. gut beraten, so wie im Archiv nicht nur das zu suchen, was sie finden wollen, sondern auch die gesamte Akte oder die gesamte Zeitung durchzublättern, im besten Fall zu lesen. Geschichtsforschung hat auch etwas mit sinnlichem Nacherleben zu tun – und sei es die harte Kärrnerarbeit, sich tage-, wochen-, monatelang durch Zeitungen und Akten durchzukämpfen, obwohl wir schon vorher wissen, dass nur ein Bruchteil dessen in die gerade aktuelle Forschungsarbeit einfließen wird.
Nun hört sich dies gut an und jeder würde und könnte dies unterschreiben, sofern wir uns hier unter Forschenden befänden, die nicht unter Zeitdruck stünden. Ich gehe mal davon aus, dass wir alle hier irgendwie diesen Zeitdruck kennen. Lassen wir mal alle sonstigen Probleme, die damit zusammenhängen, beiseite: natürlich ist es großartig und kaum zu beschreiben für jene, die noch die alten Lese-, Recherchier- und Forschungssysteme kennen und sich dennoch in den neuen tummeln. Auch wenn die Netzwelt spottet, die Kanzlerin hat vollkommen Recht, wenn sie, die Naturwissenschaftlerin, vor wenigen Tagen vom „Neuland“ bezogen aufs Internet sprach. Als Historiker kann ich nur über die Freaks der virtuellen Welt lachen, wenn sie etwas als Nicht-Neuland ansehen und deshalb die Physikerin verspotten, von dem wir alle vor 15, 20 Jahren nicht einmal ahnten, wie uns diese digitale Computerwelt verändern würde. „Google“ gibt es erst seit 1998, da hatte in Deutschland nur eine Minderheit einen internetfähigen Computer. Heute zählt jeder und jede als völlig abgehängt, die nicht über Internet, eine private e-mail-Adresse und sonst was verfügen. Und niemand könnte sicher sagen, was in zehn Jahren in „Neuland“ sein wird, mit uns gemacht haben wird. Wir leben tatsächlich in „Neuland“ – kaum jemand kann sich an die Zeit vor „Google“ erinnern.
Es bedurfte keiner großartigen intellektuellen Verrenkungen, dass eines Tages „copy“ und „paste“ zum Problem werden würden. Betrug gab es schon immer in der Wissenschaft – und anderswo ebenso. Seit einigen Jahren ist es bekanntlich zum ernsten Problem ausgewachsen. Wir erleben innerhalb einer Generation den Aufstieg einer Kulturtechnik – Computer und Internet – zum globalen Massenphänomen und haben praktisch dafür weder eine Philosophie noch eine Ethik zur Hand. Lehrer_innen verstehen ihre Schüler_innen nicht mehr, Lehrende ihre Studierenden nicht mehr – kulturhistorisch gesehen war es bislang immer umgekehrt, kulturhistorisch gesehen. Wissen und Erfahrungen werden jetzt anders angeeignet – diejenigen, die das vermitteln, haben es nur überwiegend noch nicht mitbekommen, was zum ernsten Problem werden könnte. Immer wenn unsere schwerfällige Bildungspolitik ein neues Format zulässt und sich selbst daran erfreut, ist sie bereits in der Gegenwart wieder Vergangenheit. Wir Älteren nehmen dies zum Beispiel wahr, indem wir uns über die wachsende Unbedeutung von Printmedien oder traditionellen Fernsehformaten echauffieren, wenn wir uns mokieren über all das, was die Jüngeren treiben und tun, wie sie sich Wissen aneignen, das wir nicht einmal als Wissen akzeptieren, wenn wir hinausposaunen, die virtuelle Welt wäre keine richtige Welt. Ich kenne all die Argumente, die dafür oder dagegen sprechen, gerade weil ich tagtäglich von meinen eigenen vier Kindern wie ein Mensch der Vergangenheit behandelt werde: pfleglich, liebevoll, nicht ganz ernst zu nehmen, mit ein bisschen Rücksicht, aber irgendwie auch nicht ganz von dieser Welt – mich rettet dann nur noch der Satz: nicht ganz von ihrer Welt.
Das ND, die Berliner Zeitung und die Neue Zeit stehen nun online. Das ist fraglos eine große Sache. Ich sage Ihnen auch warum. Und jetzt kommt meine andere Seite, die von Terminen gedrückten Seite, die gar nicht mehr weiß, wie Muße eigentlich geschrieben wird: mit einem „ß“, mit einem „s“ oder mit einem doppelten „s“ – das muss ich nicht einmal mehr wissen, weil mein fast perfektes Rechtschreibprogramm ohnehin alles richtet. Aber noch besser: Als ich in den 1980er oder 1990er Jahren pure Lebensdaten von Persönlichkeiten recherchierte, die es nicht in den Brockhaus, den Meyer oder die Britannica, ins Who is Who wofür auch immer, in Gelehrtenkalender und die vielen anderen Spezialnachschlagwerke, die in Handapparaten so gewöhnlich herumstehen, Eingang fanden, hatte ich tagelang zu tun, um irgendwo einen Nekrolog zu finden. Und bei dieser Suche fand ich ganz vieles heraus, was ich schon immer mal wissen wollte und weitaus mehr, was ich weder wissen wollte, noch was ich bislang als wissenswert anerkannt hatte, weil ich ja nicht wissen konnte, das ich es wissen wollte, weil ich ja nicht wusste, dass es dies zu wissen gab. Diese unendliche Suchzeit ist seit einigen Jahren erheblich abgebaut, verkürzt worden – Dank Internet, Suchmaschinen und zugänglichen Datenbanken. Dass diese nun online-stehenden Tageszeitungen gleich eine Fülle von Informationen mitliefern, ist ebenso zu würdigen wie überhaupt die Möglichkeit, eine Volltextrecherche durchführen zu können. Sie wird termingeplagten Forschern unendlich hilfreich sein, sie wird zugleich dazu beitragen – ich meine das jetzt weder kritisch noch jammernd, ich stelle es nur fest –, dass wir künftig von vielen Forschern und Forscherinnen Quellen präsentiert bekommen werden, die diese Quellen nie in der Hand hatten. Ich habe noch keine abschließende Meinung, ob dies nun schlimm ist. Ich stelle es einfach nur fest.
Vielleicht bin ich ein bisschen zu wenig festmäßig rübergekommen. Denn eigentlich wollte ich Ihnen allen nicht nur Dank sagen, dass es großartig ist, dass wir immer mehr solche Projekte, solche kompletten Zeitungen online zu stehen haben. Ich wollte Ihnen eigentlich auch sagen, dass es für mich eine derartig großartige Arbeitserleichterung darstellt, nun so von meinem Schreibtisch aus recherchieren zu können – allerdings steht mein Schreibtisch in einer Gegend, in dem die Übertragungsgeschwindigkeit so derart absurd niedrig ist, dass ich nicht selten fluche, meinen ND-Bestand der Havemann-Gesellschaft zur Dauerleihgabe vermacht zu haben.
Schon wieder habe ich eine Einschränkung gemacht – es tut mir leid. Ich bin wirklich ein Fan von diesem Projekt, wünschte mir aber, dass als nächstes die „Junge Welt“ hinzukäme, denn die ist neben dem ND die zweite wichtige Tageszeitung für die DDR.
Noch viel wichtiger aber scheint mir das Plädoyer, bitte sorgen Sie alle dafür, dass nicht nur recherchiert, sondern auch gelesen und geforscht wird. Forschen und lesen heißt, nicht nach Suchbegriffen zu recherchieren, sondern zu lesen, was man vorher nicht kannte, zu forschen, von dem man nicht wusste, dass es dies gibt. Sorgen Sie bitte dafür, wie auch immer, dass die Forschenden alte Zeitungen auch sinnlich erfahren und riechen können – denn der Blick auf die OCR-erfasste Zeitung ist ein anderer als die durchgeblätterte, in der man Seite für Seite vorsichtig, womöglich mit weißen Handschuhen – allein dies, was für ein Herzglück! – bedächtig blättert, liest, erfährt, was man nicht erfahren wollte und dennoch neue Räume erschließt. Der Geruch einer solchen Erfahrung ist ganz verschieden von dem Computerbild, wirklich. Aber: es geht hier nicht um Alternativen – ich bin wirklich so dankbar, aber diese Dankbarkeit für die OCR-Erfassung ist mir vielleicht nur möglich, weil ich diese ganze ND-Scheiße las, ertrag, roch, schleppte – und nun online recherchieren kann. Die reine online-Recherche, die ich weder verhindern will noch verhindern möchte noch könnte, soll uns aber bei allem Positivem vor Augen führen: anfassen und riechen und zur Seite schauen gehört auch zur Wissenschaft – vielleicht sogar stärker als wir uns eingestehen.
Insofern stellt für mich das Online-Vermögen eine Lust dar, die durch die wissenschaftliche Verifizierbarkeit der Quellen genauso eine Last, aber eben auch Lust ist, wie in der Zeit davor, vor Neuland, vor dem Internet, vor dem OCR-gescannten ND. Denn die Online-Recherche, ob nun in diesem tollen DDR-Zeitungsportal oder in einer der vielen anderen Online-Datenbanken kann nicht ersetzen, was wir Historiker mit der sinnlichen Erfahrung von Geschichte auch meinen. Jedenfalls stellen für mich Online-Datenbanken außerordentlich nützliche Hilfsmittel dar – aber wir alle sollten dafür tun, dass sie dies bleiben: Hilfsmittel. Aber zugleich weiß jeder Forscher und jede Forscherin, dass Hilfsmittel für die Wissenschaft so ungefähr das Wichtigste sind, worauf sie sich verlässlich stützen. Und wie verlässlich diese gesamte Edition dreier DDR-Zeitungen ist, kann ich hier nur sagen und behaupten und dankbar bezeugen.
Und umso mehr, liebe Projektmacher und -macherinnen, erscheint es mir notwendig, dass sich Ihre Seite auch auf der Homepage der Staatsbibliothek leicht finden lässt. Haben Sie mal versucht, herauszubekommen, ob jemand nur über die Homepage der Staatsbibliothek auf das Zeitungsportal stoßen könnte? Das ist ein wahres Abenteuer – wie so vieles andere in „Neuland“. Das muss ja nicht so bleiben, oder? Nein, das wird nicht so bleiben, weil „Neuland“ schon jetzt – wahrscheinlich, nehme ich an – schon wieder veraltetet ist.
Ilko-Sascha Kowalczuk



 SBB I Hagen Immel CC NC-BY-SA
SBB I Hagen Immel CC NC-BY-SA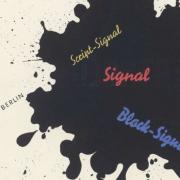







Ihr Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!